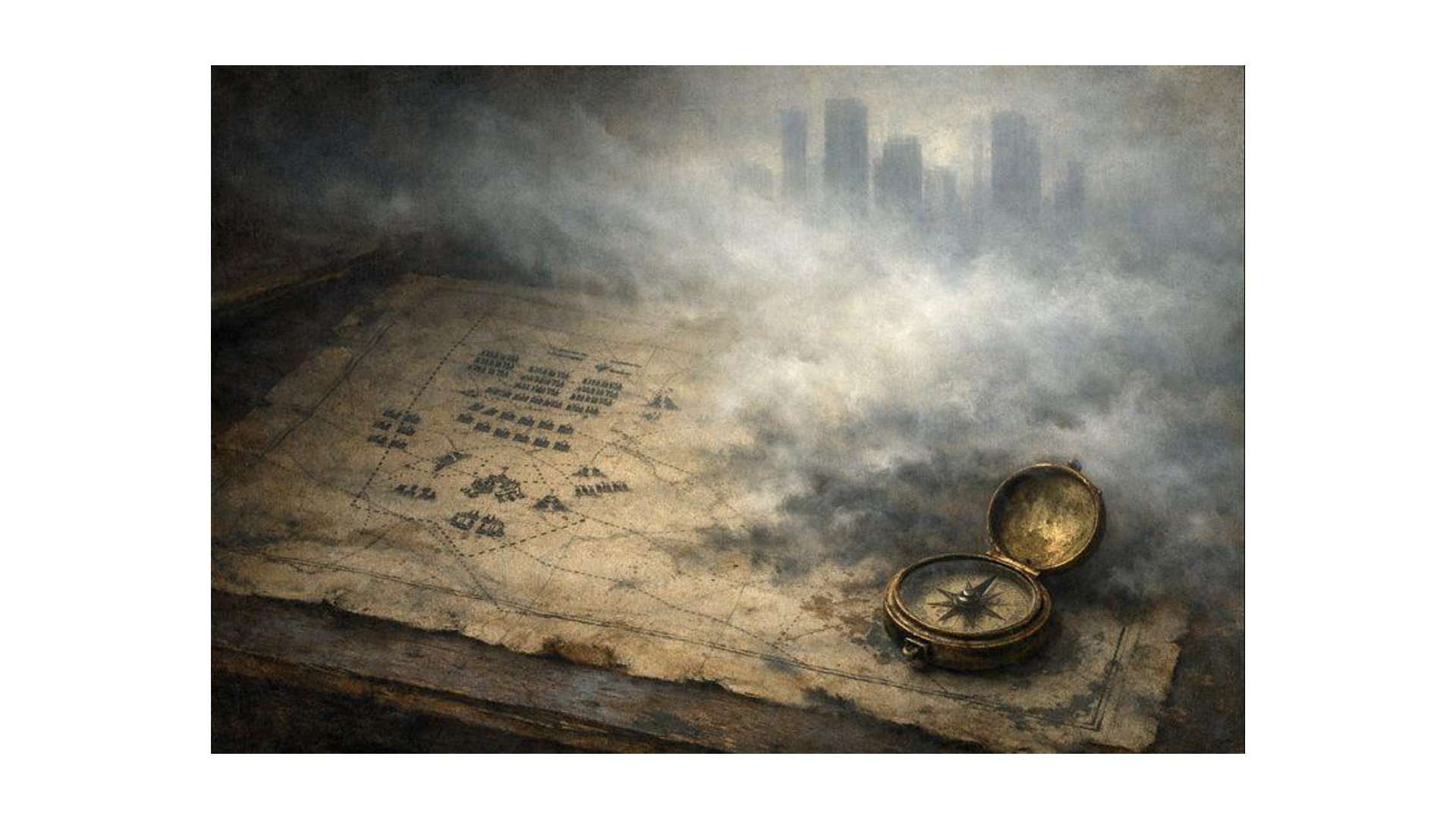Ein preußischer General schrieb vor zweihundert Jahren über die Grenzen systematischer Planung, die Unzuverlässigkeit von Nachrichten und die Kluft zwischen Entwerfen und Ausführen. Seine Beobachtungen haben nichts von ihrer Schärfe verloren.
Das Wiederlesen eines Klassikers
Carl von Clausewitz schrieb „Vom Kriege“ in den 1820er Jahren als Versuch, das Wesen des Krieges zu verstehen – nicht um Rezepte zu liefern, sondern um das Urteil zu schärfen. Wer heute seine Passagen über Informationsverzerrung, die Grenzen der Theorie und das Verhältnis von Plan und Wirklichkeit liest, begegnet einer Denkweise, die seltsam aktuell wirkt.
Clausewitz interessierte sich für die Frage, warum kluge Menschen in komplexen Situationen systematisch fehlgehen. Warum Pläne an der Realität zerschellen. Warum Organisationen ihre eigenen Absichten untergraben. Diese Fragen stellen sich nicht nur im Krieg.
Nachrichten im Kriege
Ein großer Teil der Nachrichten, die man im Kriege bekömmt, ist widersprechend, ein noch größerer ist falsch und bei weitem der größte einer ziemlichen Ungewißheit unterworfen.
Clausewitz beobachtete, dass unter Druck ein eigentümlicher Mechanismus einsetzt: „Die Furchtsamkeit der Menschen wird zur neuen Kraft der Lüge und Unwahrheit. In der Regel ist jeder geneigt, das Schlimme etwas zu vergrößern.“ Die Angst verstärkt die Verzerrung, und die Verzerrung nährt die Angst.
In Friedenszeiten kehrt sich dieser Mechanismus bisweilen um. Wo Clausewitz‘ Offiziere das Schlimme vergrößerten, neigen andere Kontexte zur gegenteiligen Bewegung: Je schwieriger die Lage, desto lauter die Zuversicht. Nicht aus Täuschungsabsicht, sondern aus der Logik der Situation. Wer Vertrauen braucht – von Geldgebern, Mitarbeitern, Partnern –, kann sich Pessimismus nicht leisten.
Die Divergenz zwischen dem Ton der Kommunikation und der Substanz des Geschehens wäre für Clausewitz keine Überraschung. Er wusste, dass „der Eindruck der Sinne stärker ist als die Vorstellungen des überlegenen Kalküls“. Die Frage ist nur, wann der Moment kommt, den er so beschreibt: „bis die Notwendigkeit uns in fliegender Eile den Entschluß abgedrängt hat, der bald als Torheit erkannt wird“.
Das Bestreben, eine positive Lehre aufzustellen
Es entstand also das Bestreben, Grundsätze, Regeln oder gar Systeme für die Kriegführung anzugeben. Hiermit setzte man sich einen positiven Zweck, ohne die unendlichen Schwierigkeiten gehörig ins Auge gefaßt zu haben.
Clausewitz‘ Kritik galt den Militärtheoretikern seiner Zeit, die glaubten, den Krieg in Regeln fassen zu können. Sein Einwand war nicht, dass Regeln unnütz seien, sondern dass sie das Wesentliche verfehlten: die „beständige Wechselwirkung“, die jede Situation einzigartig macht.
Die Theorieversuche, schrieb er, seien „in ihrem analytischen Teil als Fortschritte in dem Gebiet der Wahrheit zu betrachten, in dem synthetischen Teil aber, in ihren Vorschriften und Regeln, ganz unbrauchbar“. Sie strebten „nach bestimmten Größen, während im Kriege alles unbestimmt ist“. Sie richteten „die Betrachtung nur auf materielle Größen, während der ganze kriegerische Akt von geistigen Kräften und Wirkungen durchzogen ist“.
Man könnte fragen, ob diese Kritik auch für andere Bereiche gilt, in denen Architekturen entworfen, Standards definiert und Systeme geplant werden – während das, worauf es ankommt, sich der Planung entzieht: Verhalten, Anreize, die Dynamik von Netzwerken. Clausewitz würde vermutlich nicht behaupten, die Antwort zu kennen. Er würde die Frage stellen.
Eine Theorie soll eine Betrachtung sein
Eine Theorie soll eine Betrachtung und keine Lehre sein.
Dieser Satz enthält den Kern seiner Methode. Eine Betrachtung erzieht das Urteil, ohne Vorschriften zu machen. Sie „hellt dem künftigen Führer überall den Weg auf, erleichtert seine Schritte, erzieht sein Urteil und bewahrt ihn vor Abwegen“ – aber sie führt ihn nicht „am Gängelbande“.
Der Unterschied ist subtil, aber folgenreich. Wer Lehren befolgt, delegiert sein Urteil an die Lehre. Wer betrachtet, schärft sein eigenes. Clausewitz verglich es mit dem Unterschied zwischen dem Mathematiker und dem Feldherrn: „Das Leben mit seiner reichen Belehrung wird niemals einen Newton oder Euler hervorbringen, wohl aber den höhern Kalkül eines Condé oder Friedrich.“
Das Wissen, das in komplexen Situationen trägt, ist nicht das äußerliche Wissen der Frameworks und Methoden. Es ist ein Wissen, das „durch vollkommene Assimilation mit dem eigenen Geist und Leben in ein wahres Können“ verwandelt wurde. Ein Wissen, das in der Betrachtung wurzelt, nicht in der Lehre.
Die Kluft zwischen Entwerfen und Ausführen
Festes Vertrauen zu sich selbst muß ihn gegen den scheinbaren Drang des Augenblicks waffnen; seine frühere Überzeugung wird sich bei der Entwickelung bewähren, wenn die vorderen Kulissen, welche das Schicksal in die Kriegsszenen einschiebt, mit ihren dick aufgetragenen Gestalten der Gefahr weggezogen und der Horizont erweitert ist.
Clausewitz kannte die „große Kluft zwischen Entwerfen und Ausführen“. Der Plan, so überzeugend er auf dem Papier erscheint, begegnet in der Wirklichkeit dem, was er „Friktion“ nannte: „die unzähligen kleinen Umstände, die im Kriege alles schwieriger machen, als es scheint“.
Diese Friktion ist kein Fehler, der sich beheben ließe. Sie ist das Wesen der Sache. Organisationen haben Eigenlogiken. Menschen haben Interessen. Systeme haben Beharrungskräfte. Wer das nicht einkalkuliert, verwechselt die Landkarte mit dem Gelände.
Gegen diese Friktion, so Clausewitz, hilft kein besserer Plan. Es hilft nur das, was er „Charakter“ nennt: „Durch dieses Vorrecht, welches wir in zweifelhaften Fällen unserer früheren Überzeugung geben, durch dieses Beharren bei derselben, gewinnt das Handeln diejenige Stetigkeit und Folge, die man Charakter nennt.“
Was das Genie tut
Was das Genie tut, muß gerade die schönste Regel sein, und die Theorie kann nichts Besseres tun, als zu zeigen, wie und warum es so ist.
Clausewitz‘ Verhältnis zur Regel ist dialektisch. Er verwirft sie nicht, aber er ordnet sie ein. Das Genie erhebt sich „über die Regel“ – nicht aus Willkür, sondern weil es die Situation tiefer durchdringt als jede Regel es könnte. Die Theorie folgt dem Genie, nicht umgekehrt.
„Wehe der Theorie“, schreibt er, „die sich mit dem Geiste in Opposition setzt; sie kann diesen Widerspruch durch keine Demut gutmachen, und je demütiger sie ist, um so mehr wird Spott und Verachtung sie aus dem wirklichen Leben verdrängen.“
Das ist keine Absage an das Denken. Es ist eine Absage an ein bestimmtes Denken: das Denken, das glaubt, die Wirklichkeit in Systeme zwingen zu können. Clausewitz plädiert für ein anderes Denken – eines, das die „Schwierigkeit richtig zu sehen“ vermag, ohne sie wegzuerklären.
Am Ende: Eine Frage
Clausewitz bietet keine Rezepte. Sein Werk ist selbst eine Betrachtung, keine Lehre. Es schärft das Auge für die Muster, die sich wiederholen: die Verzerrung der Nachrichten unter Druck, die Illusion der systematischen Kontrolle, die Kluft zwischen Plan und Ausführung, der Widerstand der Wirklichkeit gegen die Theorie.
Ob diese Muster auch dort wirken, wo heute transformiert, digitalisiert und strategisch neuausgerichtet wird, muss jeder Leser selbst entscheiden. Clausewitz würde vermutlich sagen: Die Frage zu stellen ist bereits der erste Schritt zur Antwort.
Ralf Keuper