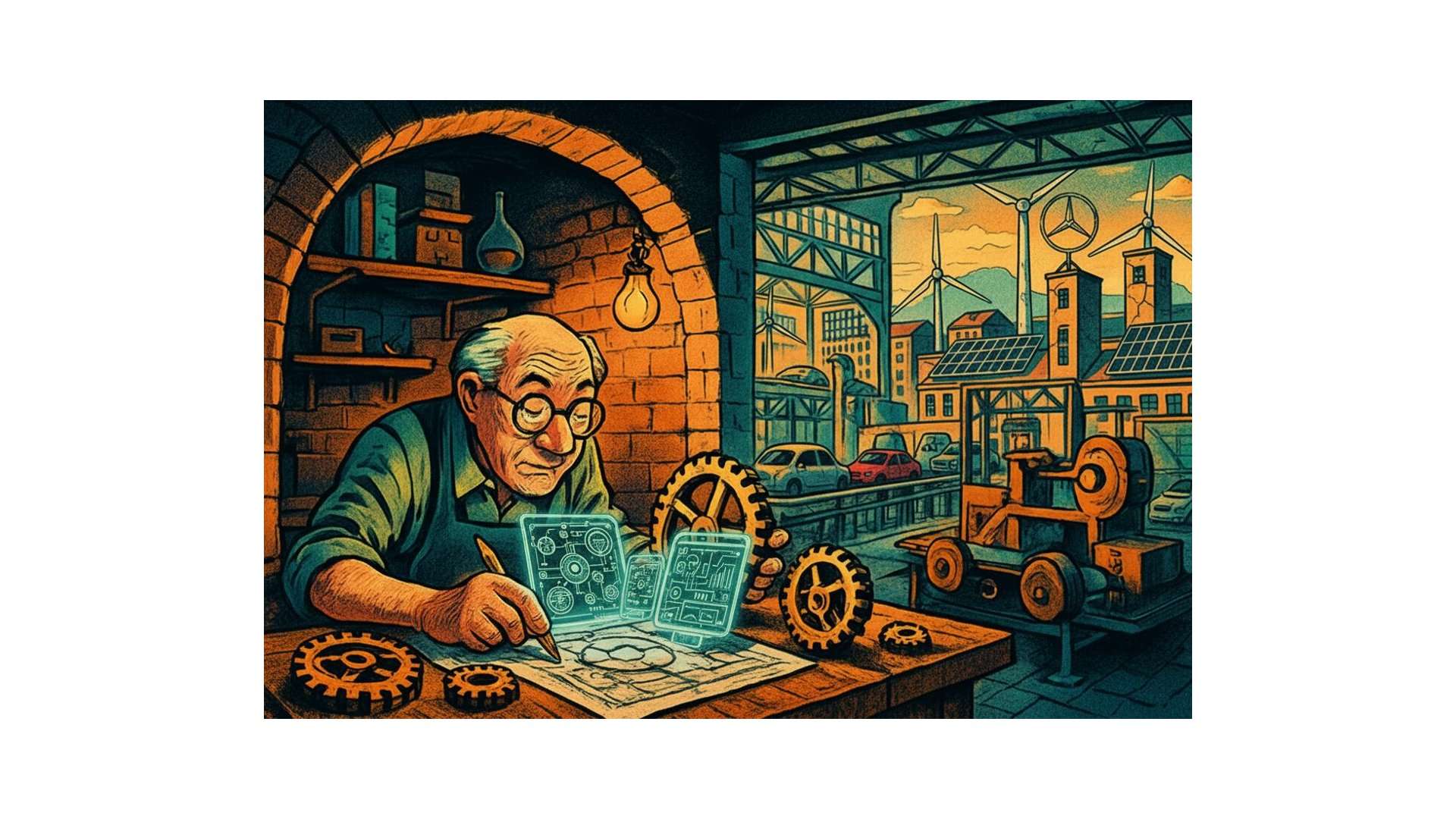Es gibt Bilder, die sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt haben: die glänzenden Sterne von Mercedes auf Stuttgarter Dächern, die Werkshallen voller Maschinen, die in alle Welt exportiert wurden, das Bild des schwäbischen Tüftlers, der im Keller an der nächsten Innovation bastelt. Baden-Württemberg war jahrzehntelang die Chiffre für deutschen Wohlstand, für Fleiß und Erfindergeist. Das „Musterländle“ – so nannten es Einheimische und Außenstehende gleichermaßen. Doch das Märchen vom ewigen Erfolg hat Risse bekommen. Heute ist aus dem Vorzeigeland ein mahnendes Beispiel für Selbstzufriedenheit und verpasste Reformen geworden.
Vom Vorzeigemodell zum Problemfall
Baden-Württemberg verdankte seinen Aufstieg einer seltenen Kombination: tüchtige Familienunternehmen, starke Leitindustrien, eine Bildungslandschaft, die in den 1970er- und 80er-Jahren zu den besten der Republik zählte. Der Exportboom machte das Land reich, der Mittelstand erfand sich immer wieder neu, Ingenieure galten als stille Helden des „Wirtschaftswunders“. Noch um die Jahrtausendwende lag Baden-Württemberg bei Produktivität, Patentanmeldungen und Bildungsstandards ganz vorne.
Heute zeigt sich ein anderes Bild. Der Kern des Wohlstands – Autoindustrie und Maschinenbau – steckt in einer tiefen Transformation, deren Tempo unterschätzt wurde. Während die Welt längst auf Elektromobilität und Software setzt, hielten viele Unternehmen im Südwesten am Verbrennungsmotor und an klassischen Fertigungsmodellen fest. China und die USA investieren Milliarden in neue Technologien, Baden-Württemberg dagegen verliert Jahr für Jahr Marktanteile.
Bildung als Schwachstelle
Besonders schmerzhaft ist der Niedergang des Bildungssystems. Einst Vorbild für ganz Deutschland, belegt das Land inzwischen in bundesweiten Vergleichsstudien die hinteren Plätze. Der IQB-Bildungstrend zeigt deutliche Leistungseinbrüche in Mathematik und Deutsch, Lehrermangel und überlastete Schulen prägen den Alltag. Damit bröckeln die Grundlagen für die Innovationskraft, auf die Baden-Württemberg so stolz war.
Doch anstatt dieses Problem entschieden anzugehen, griff die Politik gerne auf ein bequemes Erklärungsmuster zurück: den angeblichen Fachkräftemangel. Was nach nüchterner Diagnose klingt, ist in Wahrheit eine Fata Morgana. Ingenieure und Informatiker gibt es durchaus – nur passen ihre Profile oft nicht in die engen Raster der Unternehmen.
Das Bild des Mangels verschleiert so, dass das eigentliche Problem tiefer liegt: ein Missmanagement von Bildung, Qualifikation und Strukturwandel.
Patentillusionen
Lange konnte sich Baden-Württemberg zudem mit beeindruckenden Patentstatistiken schmücken. Konzerne wie Bosch oder Daimler meldeten Jahr für Jahr Tausende neuer Schutzrechte an – ein vermeintlicher Beweis für die Innovationskraft des Landes. Doch die Zahlen trügen. Der Großteil dieser Patente drehte sich um inkrementelle Verbesserungen bestehender Technologien, vor allem rund um den Verbrennungsmotor.
So wuchsen Papierberge von Schutzrechten, die zwar bestehende Geschäftsmodelle absicherten, aber selten wirkliche Disruption bedeuteten. Viele Patente wurden „defensiv“ angemeldet – um Wettbewerber auszubremsen, nicht um neue Märkte zu erschließen.
Währenddessen setzten Player wie Tesla auf wenige, strategisch bahnbrechende Erfindungen – und öffneten diese später sogar bewusst, um eine neue Industrie zu befeuern.
Die baden-württembergische Patentflut erwies sich damit als Zerrspiegel der Innovationskraft: Sie zeigte nicht den Aufbruch in die Zukunft, sondern die Selbstvergewisserung in alten Technologien.
Personenkult statt Strukturen
Symptomatisch für den Aufstieg wie für den Niedergang war die Neigung zum Personenkult. An die Stelle funktionierender Strukturen traten überhöhte Einzelgestalten, die als Projektionsflächen für Erfolg und Zukunft dienten.
Lothar Späth, der „Cleverle“ der 1980er-Jahre, inszenierte sich als Landesvater der Innovation – bis sein Rücktritt wegen einer Affäre um Gefälligkeiten den Mythos zerstörte[1]Späth pflegte enge Kontakte zu Wirtschaftsführern und prägte das Modell des „politischen Netzwerkers“, der Landesinteressen proaktiv mit Export und Industrie verknüpfte. Kritiker sahen darin … Continue reading. Seine Selbststilisierung spiegelte die Haltung einer ganzen Region: Erfolg als persönliche Gabe, nicht als Ergebnis harter Strukturarbeit.
Ähnlich verhielt es sich in der Wirtschaft. Hans-Lutz Merkle, langjähriger Chef von Bosch, ließ sich von seinen Mitarbeitern und den Medien als „Gottvater“ titulieren – eine Machtsymbolik, die eher an feudale Herrschaft als an moderne Unternehmensführung erinnerte. Nicola Kammüller-Leibinger wiederum, Chefin des Maschinenbauers Trumpf, sucht die Öffentlichkeit wie kaum eine andere Unternehmerin in der Region[2]Frau Kammüller-Leibinger fühlt sich anscheinend ohnehin berufen, zu verschiedenen Themen öffentlich ihre Meinung kundzutun, wobei für Außenstehende nur schwer zu erkennen ist, welche Expertise … Continue reading[3]Neben Kammüller-Leibinger scheinen auch Wolfgang Grupp und Reinhold Würth über eine Standleitung in die Redaktionen zu verfügen.
Diese Fixierung auf vermeintlich charismatische Figuren wirkte wie ein doppeltes Gift: Sie überdeckte die Notwendigkeit tieferer Reformen und schuf ein Klima, in dem Kritik oder Querdenken kaum Gehör fanden. Der Personenkult wurde zum Ersatz für eine nachhaltige Innovationskultur – und bereitete damit den Boden für den heutigen Stillstand.
Externe Schocks als Brennglas
Die Corona-Pandemie wirkte wie ein Katalysator. Die extreme Exportabhängigkeit, jahrzehntelang Stolz und Stärke, wurde zur Achillesferse. Als Lieferketten brachen und Aufträge ausblieben, zeigte sich, wie verwundbar Baden-Württembergs Modell war. Energiekrise und geopolitische Spannungen verstärkten den Druck. Während andere Regionen flexibel reagierten, verharrte das Musterländle in Strukturen, die für die Welt von gestern gebaut waren.
Eine Region auf der Suche nach Zukunft
Baden-Württemberg hat seinen Platz an der Spitze verloren, weil es zu lange glaubte, ihn nicht verteidigen zu müssen. Bildung, Digitalisierung, Infrastruktur – zentrale Felder wurden vernachlässigt. Der Mythos vom ewigen Erfolg erwies sich als gefährliche Illusion.
Die Chancen des Südwestens sind heute nicht besser als die der anderen Bundesländer – und das heißt: eher schlecht. Der strukturelle Wandel, der nötig wäre, um im globalen Wettbewerb wieder mitzuhalten, ist kein Projekt von fünf oder zehn Jahren. Er wird mehrere Generationen in Anspruch nehmen. In einer Welt, die sich im Takt von Jahrzehnten neu erfindet, ist das ein riskanter Zeitverzug.
Das „Musterländle“ ist damit nicht nur ein Lehrstück über Selbstzufriedenheit, sondern auch ein Menetekel für ganz Deutschland: Wer glaubt, vom Kapital alter Erfolge dauerhaft leben zu können, wird feststellen, dass die Gegenwart schneller veraltet, als einem lieb ist.
Quellen:
Ursachen der Produktivitätsschwäche Baden-Württembergs
Bedrohlichere Lage als während der Finanzkrise: Ökonom sieht Baden-Württemberg in Strukturkrise
Dank an das coole Cleverle ausm Ländle
DIE ZUKUNFT DER DEUTSCHEN AUTOMOBILINDUSTRIE. Transformation by Disaster
oder by Design?
Stuttgarts Automobilindustrie – Das neue Detroit?
„Stuttgart könnte das neue Ruhrgebiet werden“: Wie hart trifft die Krise die Autostädte?
Trumpf: Aufstieg und Niedergang eines deutschen Maschinenbau-Champions
Alarm aus dem Südwesten. Aufschwung ist verschoben
Die Grüne Transformation der deutschen Automobilindustrie: Eine Patentdatenanalyse
Lothar Späth tritt nach „Traumschiff-Affäre“ zurück
References
| ↑1 | Späth pflegte enge Kontakte zu Wirtschaftsführern und prägte das Modell des „politischen Netzwerkers“, der Landesinteressen proaktiv mit Export und Industrie verknüpfte. Kritiker sahen darin jedoch eine undurchsichtige Vermischung von Macht und Einfluss, die bis zur Vorteilsnahme und zu eigennützigen Gefälligkeiten führte, wie Späths Rücktritt infolge der sogenannten Dienstreisen-Affäre zeigte. Oettinger setzte diese Verbindung fort, stieg in der EU-Karriere und war für wirtschaftsliberale Reformen bekannt. Mappus geriet während seiner Amtszeit in die Schlagzeilen wegen des umstrittenen EnBW-Deals und enger Beziehungen zu Wirtschaftsakteuren wie Investmentbanker Dirk Notheis – ein Beispiel für die problematische Nähe zwischen Regierungsspitze und Konzernen. Späth ließ sich nach seiner Karriere als Politiker als Retter von Jenaoptik feiern. Bei nüchterner Betrachtung stellte sich die Erfolgsstory als nicht mehr ganz so glanzvoll dar: Lothar Späth Schulden-Porträt als Ministerpräsident Baden-Württembergs.Ein kritisches Politökonomisches-Brennpunkt-Porträt |
|---|---|
| ↑2 | Frau Kammüller-Leibinger fühlt sich anscheinend ohnehin berufen, zu verschiedenen Themen öffentlich ihre Meinung kundzutun, wobei für Außenstehende nur schwer zu erkennen ist, welche Expertise sie mitbringt. Aber Expertise ist heutzutage ja wohl nicht mehr nötig, es reicht, prominent zu sein |
| ↑3 | Neben Kammüller-Leibinger scheinen auch Wolfgang Grupp und Reinhold Würth über eine Standleitung in die Redaktionen zu verfügen |