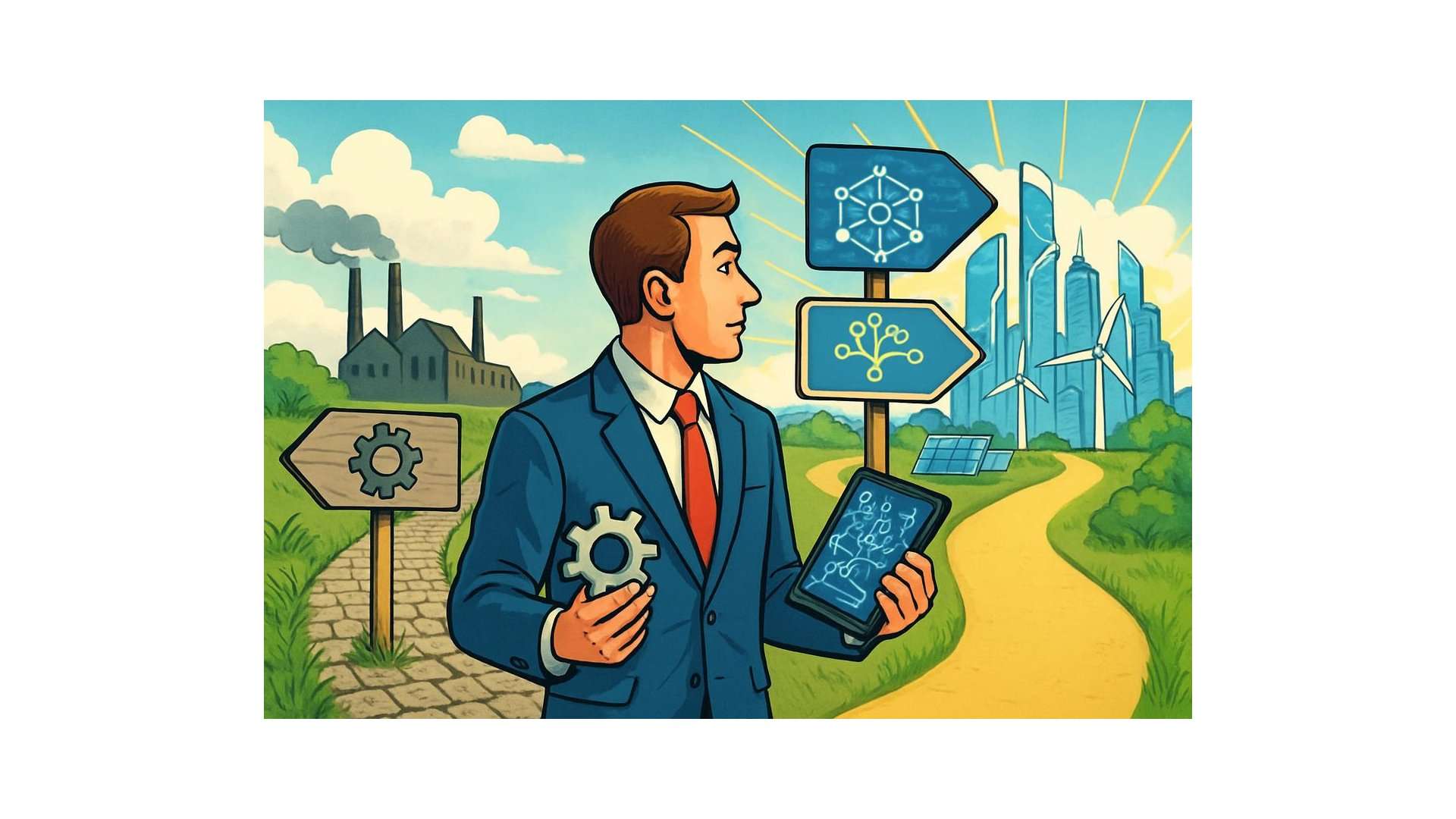Stagnation, gedämpfte Erwartungen, nostalgische Rückbesinnung auf vergangene Stärken – die deutsche Wirtschaft taumelt, während manche an bewährte Tugenden appellieren. Doch was, wenn diese Rezepte nicht mehr greifen? Ein Blick in die Geschichte zeigt: Schon einmal stand Deutschland an einem Wendepunkt, als die Realität die Illusion einholte. Die Parallelen zu 1917/18 sind verblüffend – und beunruhigend.
Es gibt Momente in der Geschichte, in denen Nationen an Wendepunkten stehen, ohne es zunächst wahrhaben zu wollen. Deutschland erlebt einen solchen Moment – nicht zum ersten Mal. Die aktuelle wirtschaftliche Malaise, verbunden mit einem merkwürdigen Cocktail aus Nostalgie und Zukunftsangst, erinnert auf beunruhigende Weise an die Jahre 1917 und 1918, als das Kaiserreich trotz seiner gewaltigen Heeresmacht längst strategisch gescheitert war, dies aber nicht wahrhaben wollte.
Die Illusion vom unvermeidlichen Sieg
Im Herbst 1917 glaubten viele in Deutschland noch an die militärische Wende. Die Armee stand tief in Frankreich und Belgien, im Osten schien mit dem revolutionären Russland Frieden möglich. Doch die strategische Realität sah anders aus: Die Blockade würgte die Wirtschaft ab, die Ressourcen schwanden, und mit dem Kriegseintritt der USA war das Kräftegleichgewicht endgültig gekippt. Erst 1918, als es längst zu spät war, erkannte die Oberste Heeresleitung unter Ludendorff die Notwendigkeit eines strategischen Rückzugs. Der Schock dieser späten Einsicht erschütterte die Gesellschaft bis in ihre Grundfesten.
Heute ist es nicht das Militär, sondern die Wirtschaft, die ins Straucheln geraten ist. Deutschland, einst stolze Exportnation und industrielles Kraftzentrum Europas, wächst 2025 kaum noch. Unternehmen investieren zögerlich, die Stimmung ist pessimistisch, ein schneller Aufschwung wird nicht erwartet. Und dennoch: Der Glaube an die altbewährten Stärken hält sich hartnäckig.
Das Ingenieursdenken als Heilsversprechen?
„Deutsche Tugenden“, „Ingenieursdenken“, „Qualität made in Germany“ – diese Begriffe tauchen reflexhaft auf, wenn nach Rezepten gegen die Krise gesucht wird. Zweifellos bilden technisches Know-how und methodische Präzision wichtige Grundpfeiler des Wirtschaftsstandorts. Maschinenbau, Automobilindustrie, Hightech – hier liegt historisch die deutsche Stärke.
Doch reicht das noch? Die Welt hat sich fundamental verändert. Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit, interdisziplinäres Arbeiten – diese Zukunftsfelder verlangen mehr als das bloße Festhalten an bewährten Mustern. Wie die Ingenieure beim Deutschen Ingenieurtag 2025 selbst diskutierten[1]Deutscher Ingenieurtag 2025: Zukunft des Standorts Deutschland im Fokus: Tradition allein ist keine Strategie. Die Herausforderungen der globalisierten, digitalen Welt erfordern ein Umdenken, eine Innovationsoffenheit, die über nostalgische Rückbesinnung hinausgeht.
Die Parallele zu 1918 ist verblüffend: Auch damals verfügte Deutschland über enorme Ressourcen und Fähigkeiten – eine der schlagkräftigsten Armeen der Welt, hochentwickelte Industrie, wissenschaftliche Exzellenz. Dennoch fehlte die strategische Weitsicht, rechtzeitig umzusteuern. Das Festhalten an der Vorstellung, mit den alten Mitteln und Methoden doch noch siegen zu können, verzögerte die notwendige Anpassung an neue Realitäten.
Die gefährliche Verlockung der Dolchstoßlegende
Was nach 1918 folgte, sollte als Warnung dienen. Statt die strategischen Fehler der militärischen und politischen Führung aufzuarbeiten, griff eine Legende um sich, die bis heute nachwirkt: die Dolchstoßlegende. Feldmarschall Hindenburg und andere behaupteten, das im Felde unbesiegte Heer sei von der Heimatfront – Sozialdemokraten, Streikenden, „Verrätern“ – erdolcht worden. Diese Erzählung war nicht nur historisch falsch, sie war politisch toxisch. Sie diente dazu, Verantwortung abzuwälzen, Sündenböcke zu benennen und die Gesellschaft zu spalten.
Die Parallelen zu heutigen Diskursen sind unübersehbar. Auch heute wird zunehmend mit dem Finger auf vermeintliche innere Feinde gezeigt: auf Politiker, die angeblich Interessen verraten, auf gesellschaftliche Gruppen, die den Fortschritt behindern, auf „die da oben“ oder „die anderen“, die schuld seien an Misere und Stagnation. Diese Rhetorik ist gefährlich, weil sie von den tatsächlichen strukturellen und systemischen Problemen ablenkt – von versäumten Investitionen in Bildung und Infrastruktur, von zu zögerlicher Digitalisierung, von der Abhängigkeit von überholten Geschäftsmodellen.
Der notwendige Realismus
Was Deutschland heute braucht, ist nicht Nostalgie, sondern Realismus. So wie Ludendorff 1918 spät, aber immerhin, die Notwendigkeit eines strategischen Rückzugs erkannte – eine Verkürzung der Frontlinie zur Schadensbegrenzung –, so muss auch heute ein pragmatisches Umdenken erfolgen. Das bedeutet nicht, bewährte Stärken aufzugeben, sondern sie weiterzuentwickeln und mit neuen Kompetenzen zu verbinden.
Die Gefahr liegt darin, zu lange am Alten festzuhalten und die Anpassung an neue Realitäten zu verschleppen. Wer heute noch glaubt, mit den Methoden und Strukturen der Vergangenheit die Zukunft meistern zu können, wiederholt den Fehler von 1917: den Glauben an eine Wende, die strategisch längst unmöglich geworden ist.
Ein Aufruf zur nüchternen Bestandsaufnahme
Die historische Parallele ist kein Untergangs-Szenario, sondern eine Aufforderung zur Wachsamkeit. Deutschland steht an einem kritischen Punkt – aber noch ist Zeit zum Handeln. Was 1918 fehlte und was heute dringend gebraucht wird, ist die Bereitschaft, unbequeme Wahrheiten anzuerkennen: dass sich die Welt verändert hat, dass alte Erfolgsrezepte nicht automatisch auch morgen funktionieren, dass Schuldzuweisungen keine Lösungen sind.
Ein Bewusstsein für diese historischen Mechanismen kann helfen, die gesellschaftlichen Diskussionen sachlicher und konstruktiver zu führen. Statt in Legenden und Schuldzuweisungen zu verfallen, braucht es einen ehrlichen Blick auf die Herausforderungen – und den Mut, neue Wege zu gehen. Nur so lässt sich vermeiden, dass aus einer Phase der Schwäche eine tiefgreifende Krise wird. Die Lektion von 1918 sollte sein: Realismus rechtzeitig ist besser als Illusionen bis zum bitteren Ende.
References