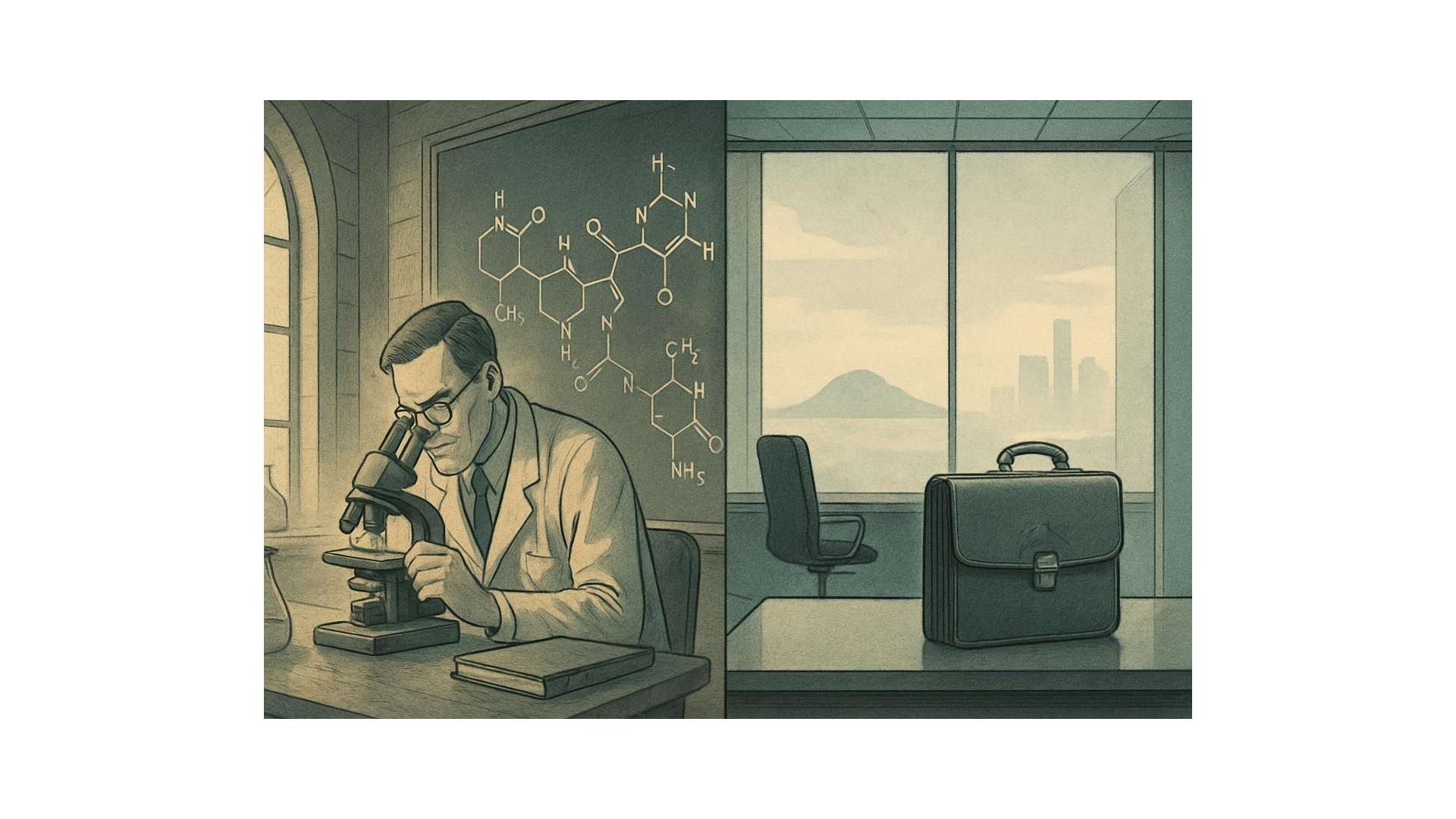Die Geschichte von Boehringer Mannheim gilt als Paradebeispiel deutscher Pharmaforschung: Aus einem bescheidenen Chinin-Produzenten wurde ein weltführendes Unternehmen der enzymatischen Diagnostik. Doch das Ende dieser Erfolgsgeschichte offenbart, was geschieht, wenn aus Familienunternehmertum Finanzkapitalismus wird – und 19 Milliarden Mark ihren Weg über Bermuda nehmen, ohne dass Staat oder Stadt auch nur eine Mark davon sehen.
Das Paradox des forschenden Unternehmens
Es gibt Wirtschaftsgeschichten, die sich zu gut lesen, um wahr zu sein. Die von Boehringer Mannheim gehört dazu – zumindest bis zu jenem Moment, als die wissenschaftliche Erfolgserzählung in einer Bermuda-Konstruktion endet. Ernst Peter Fischer, Naturwissenschaftler und ehemaliger Mitarbeiter von Max Delbrück, hat dem Unternehmen ein Denkmal gesetzt: „Wissenschaft für den Markt“ heißt sein Buch, und der Titel ist Programm. Fischer beschreibt, wie aus naturwissenschaftlicher Exzellenz ein Weltkonzern entstand. Was er nicht mehr beschreiben konnte – das Buch erschien Jahre vor dem Verkauf – war das Ende dieser Geschichte. Ein Ende, das Fragen aufwirft über das Verhältnis von Wissenschaft, Kapital und Gemeinwohl.
Die Geburt der enzymatischen Diagnostik
Der Aufstieg Boehringer Mannheims vollzog sich in mehreren Wellen. Zunächst war es Friedrich Engelhorn, ältester Sohn des BASF-Gründers, der das Unternehmen Ende des 19. Jahrhunderts zu einem forschenden Betrieb machte. Alkaloide – stickstoffhaltige Substanzen von Pflanzen, gleichermaßen Gift wie Heilmittel – bildeten die Grundlage. Chinin gegen Malaria wurde zum ersten großen Erfolg. Bereits in den 1920er Jahren galt: Nur ein Prozent der entwickelten Präparate schaffte es auf den Markt. Das pharmazeutische Geschäft war schon damals Hochrisiko-Forschung.
Der eigentliche Durchbruch kam nach 1954, als Hans Ulrich Bergmeyer die biochemische Sektion in Tutzing übernahm. Seine Vision: Enzyme für quantitative Bestimmungen anwendungsfertig zu liefern. Die enzymatische Diagnostik revolutionierte die Medizin. Enzyme, diese „Wunderwerke der Natur“, die in jeder Zelle unglaubliche Leistungen vollbringen, wurden zum Diagnoseinstrument. Wenn Zellwände durch Krankheit durchlässig werden, gelangen Enzyme in die Blutbahn – und können dort nachgewiesen werden. Organschäden und Anomalien wurden messbar.
Die Zahlen sprechen für sich: 1975 machten Diagnostika noch 22,5 Prozent des Umsatzes aus, zehn Jahre später bereits 61,8 Prozent. Die „diagnostische Trockenchemie“ – Teststreifen für Urin und Blut – machte hochkomplexe Laboranalysen einfach und verfügbar. Universitätsinstitute mussten ihre Forschungsreagenzien nicht mehr selbst herstellen, sondern konnten sie günstiger und in besserer Qualität von Boehringer Mannheim beziehen. Wissenschaft wurde zur Infrastruktur.
Das Familienunternehmen und seine Transformation
Drei Generationen Engelhorn prägten Boehringer Mannheim. Jede verkörperte eine andere Phase des Kapitalismus. Friedrich Engelhorn stand für den forschenden Unternehmer des Industriezeitalters. Die mittlere Generation für die Konsolidierung. Und dann kam Curt Engelhorn, in den USA ausgebildet, geprägt von modernen Managementmethoden. Er war es, der die erste feindliche Übernahme eines US-Unternehmens durch einen deutschen Konzern durchführte – ein Bruch mit der Tradition des Familienkapitalismus.
1985 folgte der entscheidende Schritt: die Gründung einer Dachgesellschaft namens Corange auf den Bermudas. Fischer nennt diesen Schritt im Rückblick „glücklich“ – glücklich für die Familie Engelhorn jedenfalls. Als Boehringer Mannheim 1997 für 19 Milliarden Mark an Hoffmann La Roche verkauft wurde, sah weder der deutsche Staat noch die Stadt Mannheim auch nur eine Mark davon. Das Geld floss über Bermuda.
Die Synergetik und ihr Ende
Fischer schwärmt von der „Synergetik“ bei Boehringer Mannheim: das Zusammenspiel von Therapeutika, Diagnostika und Biochemika. Tatsächlich war diese Integration ein Erfolgsmodell. Gentechnik, DNA-Diagnostik, gentechnisch hergestelltes Erythropoietin (EPO) – Boehringer Mannheim stand an allen Fronten des biomedizinischen Fortschritts.
Doch Synergetik funktioniert nur, solange das System integriert bleibt. Der Verkauf an Roche zerschlug diese Einheit. Die „Paradise Papers“ sollten später zeigen, wie tief die Engelhorn-Vermögen in internationale Steuerkonstruktionen eingebettet waren.
Was von der Wissenschaft übrig bleibt
Die Geschichte Boehringer Mannheims ist exemplarisch für eine Transformation: vom forschenden Familienunternehmen zum Finanzprodukt. Drei Generationen bauten ein Unternehmen auf, das wissenschaftliche Exzellenz mit unternehmerischem Erfolg verband. Die vierte Generation verwandelte es in liquide Mittel.
Fischer fehlt, bei aller fachlichen Kompetenz, die kritische Distanz. Er schreibt die Geschichte des „forschenden Unternehmens“, aber nicht die Geschichte seiner Verwertung. Das ist kein Vorwurf – zum Zeitpunkt seiner Arbeit war das Ende noch nicht absehbar. Aber es ist eine Leerstelle. Denn die Frage, die sich stellt, lautet: Wem gehört eigentlich die Wissenschaft, die in solchen Unternehmen produziert wird? Wem gehören die Gewinne aus Forschung, die auf öffentlicher Infrastruktur aufbaut – auf Universitäten, auf staatlich finanzierter Grundlagenforschung, auf einem Gesundheitssystem, das als Absatzmarkt dient?
Wenn Familienunternehmen ihre Bindung an Standort und Gemeinschaft verlieren, wenn sie zu bloßen Vermögenswerten werden, die sich über Bermuda optimieren lassen, dann ist das kein individuelles Versagen. Es ist die Logik des späten Kapitalismus.
Ein Stück Wirtschaftsgeschichte – mit Fußnoten
Boehringer Mannheim bleibt ein wichtiges Stück Wirtschaftsgeschichte. Die enzymatische Diagnostik hat die Medizin verändert. Die wissenschaftlichen Leistungen sind real. Aber die Geschichte lehrt auch: Wissenschaftliche Exzellenz schützt nicht vor Finanzialisierung. Im Gegenteil – sie macht ein Unternehmen erst richtig interessant für den globalen Kapitalmarkt.
Ernst Peter Fischer hat ein lesenswertes Buch über die wissenschaftliche Seite geschrieben. Die wirtschaftliche Seite, die politische Seite, die moralische Seite – die blieben Fußnoten. Manchmal sind es aber gerade die Fußnoten, die am meisten erzählen.
Quelle:
Wissenschaft für den Markt. Das forschende Unternehmen Boehringer Mannheim