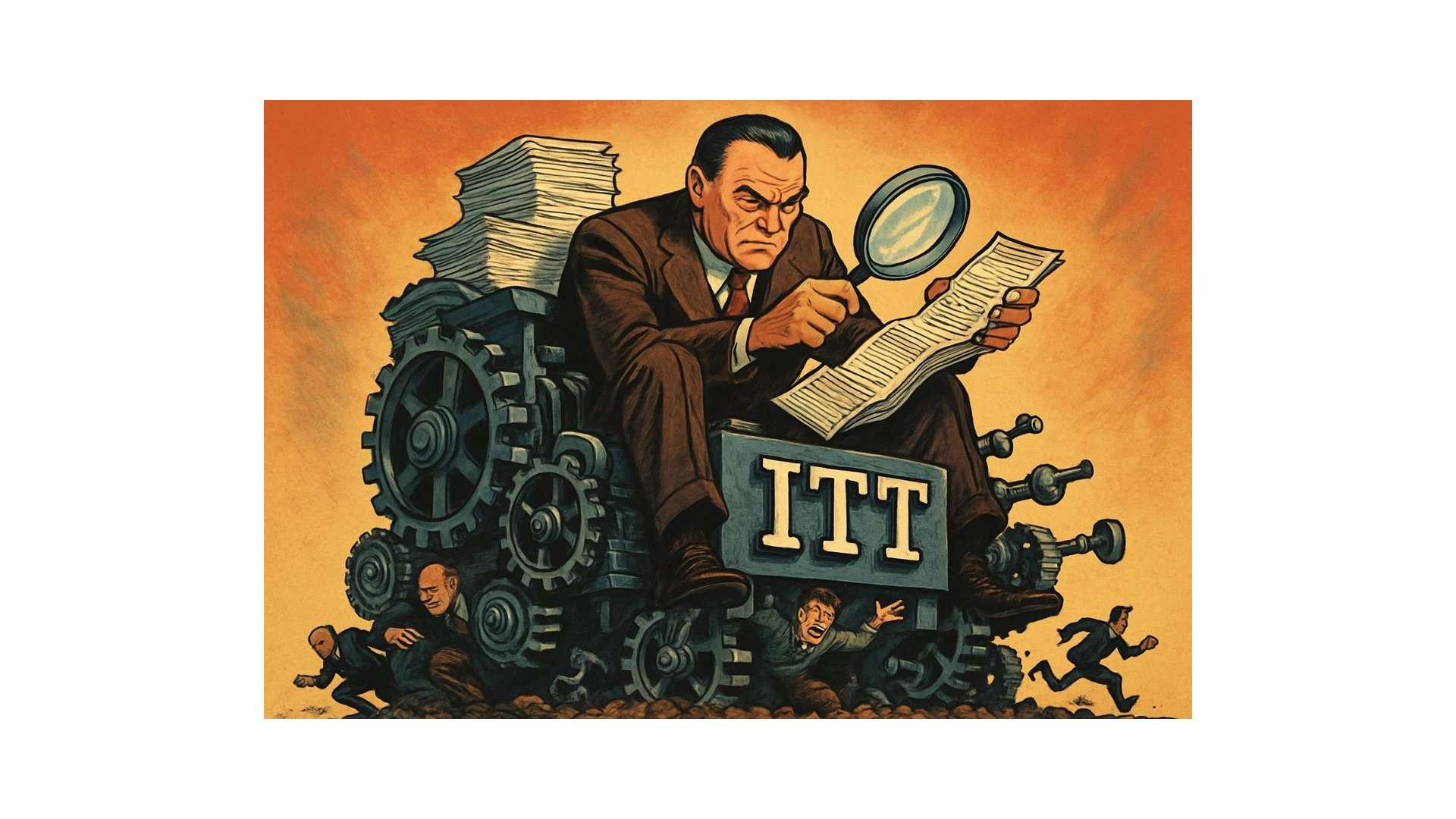Er baute einen der größten Konzerne Amerikas auf, etablierte Management durch Kontrolle und Misstrauen – und hinterließ ein System, das nach seinem Abgang in sich zusammenfiel. Harold Geneen galt als brillanter CEO, doch sein Vermächtnis offenbart die Schattenseiten eines Führungsstils, der Innovation erstickte und selbst die New York Times zu einer bemerkenswerten Warnung veranlasste: Keine marxistische Kritik könnte dem Bild amerikanischer Konzerne mehr schaden als das, was ITT unter Geneen verkörperte.
Harold Geneen war in den 1960er und 1970er Jahren mehr als nur ein erfolgreicher Manager. Als Chairman und CEO der International Telephone and Telegraph Corporation (ITT) verkörperte er eine Ära des aggressiven Konglomeratswachstums, die das amerikanische Wirtschaftsleben prägte. Aus einem bescheidenen Telekommunikationsunternehmen formte er durch unzählige Übernahmen einen globalen Mischkonzern, dessen Expansion beispiellos war. Die Hartford Fire Insurance Company war nur eine von vielen großen Akquisitionen, die ITT zu einem der mächtigsten Wirtschaftsimperien ihrer Zeit machten.
Doch hinter der Fassade des Erfolgs verbarg sich ein System, das auf strikter Kontrolle, minutiöser Überwachung und einer zahlenorientierten Führungsphilosophie basierte. Geneen glaubte an klare Strukturen und präzise Systeme – so sehr, dass er behauptete, sein Managementapparat sei so durchorganisiert, dass „selbst ein Affe ihn führen könnte“. Diese Aussage offenbart mehr als nur Selbstbewusstsein: Sie verrät eine Verachtung für unternehmerische Intuition und individuelle Kreativität.
Der Führungsstil Geneens war geprägt von Misstrauen und Kontrolle. Er forderte detaillierte Berichte, überwachte persönlich operative Details und schuf eine Atmosphäre ständiger Rechenschaftspflicht. Seine Mitarbeiter standen unter enormem Druck, vorhersehbare Ergebnisse zu liefern. Überraschungen wurden nicht toleriert. Innovation und experimentelles Denken hatten in diesem System keinen Platz. Anthony Sampson, der in seinem Buch über ITT die Mechanismen des Konzerns offenlegte, beschrieb eine Unternehmenskultur, in der echte Unternehmer, Querdenker und Forscher systematisch ausgeschlossen wurden. Erfindungen und originelle Ideen waren nicht erwünscht – sie galten als Risikofaktoren in einem auf Berechenbarkeit ausgelegten System.
Die Strategie war auf den ersten Blick durchaus rational: ITT kaufte Unternehmen, sanierte sie durch Effizienzsteigerungen und verkaufte sie bei Bedarf wieder. Kurzfristig ließ sich so tatsächlich Verschwendung eliminieren. Doch Geneen wollte dieses System nicht als temporäre Maßnahme etablieren, sondern als ewiges Prinzip verankern. Diese Logik, so Sampson, war nicht nachvollziehbar – ein System, das auf permanenter Kontrolle und Kurzzeitoptimierung basierte, konnte keine langfristige Innovationskraft entwickeln.
Die moralischen und politischen Dimensionen von Geneens Amtszeit werfen noch dunklere Schatten auf sein Vermächtnis. ITT war in mehrere skandalöse Affären verwickelt, die weit über übliche Geschäftspraktiken hinausgingen. Der Konzern bot der CIA Geld für Aktivitäten an, die einen Putsch in Chile unterstützen sollten. Geneen selbst bestätigte diese Angebote, sah darin aber nichts Verwerfliches. Während der Watergate-Ära wurden zudem undurchsichtige Verbindungen zur Nixon-Administration offenbar, und Antitrust-Verfahren begleiteten die aggressive Expansionspolitik des Konzerns. Diese Verstrickungen in Geheimdienstaktivitäten, Korruption und politische Machtspiele verbanden den Namen Geneen dauerhaft mit den dunkelsten Kapiteln amerikanischer Unternehmensgeschichte.
Die New York Times formulierte eine bemerkenswerte Einschätzung: Keine marxistische Kritik könnte das Bild großer amerikanischer Konzerne schädlicher beeinflussen als das Verhalten von ITT unter Geneen. Diese Warnung ist von außerordentlicher Bedeutung. Sie stammt nicht aus einem radikalen Pamphlet, sondern aus dem Herzen des amerikanischen Establishments. Sie besagt nichts Geringeres, als dass Geneens Geschäftspraktiken die Reputation des Kapitalismus selbst gefährdeten – nicht durch ideologische Angriffe von außen, sondern durch das eigene Verhalten.
Anthony Sampson prognostizierte, dass ITT nach Geneens Ausscheiden auseinanderfallen würde. Das System war vollständig auf seine Person zugeschnitten, auf seine Kontrolle und seine Art der Führung. Ohne ihn würden die strukturellen Schwächen offenbar werden: der Mangel an echten Unternehmerpersönlichkeiten, die fehlende Innovationskraft, die Unfähigkeit, sich aus eigener Kraft weiterzuentwickeln. Die Geschichte gab Sampson recht. Nach Geneens Abgang erwies sich ITT als unfähig, Zusammenhalt und Dynamik zu bewahren. Der Konzern zerfiel, weil das Fundament nie stark genug war – weil es auf Unterdrückung von Kreativität und systematischer Eliminierung unternehmerischen Geistes gebaut worden war.
Harold Geneen wird oft zwiespältig bewertet. Die Darstellung seiner Karriere schwankt zwischen Bewunderung für seine Management-Fähigkeiten und Kritik an seinem autoritären Stil. Doch viele Würdigungen bleiben zu schmeichelhaft, zu fokussiert auf kurzfristige Erfolge. Sie übersehen oder verharmlosen die langfristigen Schäden: die Kultur des Misstrauens, die Vertreibung von Talenten, die Verhinderung von Innovation, die moralischen Abgründe.
Geneens Werkzeugkasten bestand aus Kontrolle, Misstrauen und Machtspielchen. Er schuf ein System, das Effizienz über alles stellte und dabei die menschlichen und kreativen Grundlagen erfolgreichen Unternehmertums zerstörte. Sein Vermächtnis ist ambivalent: Er war zweifellos ein brillanter Organisator, aber seine Brillanz diente einem System, das Innovation erstickte, Unternehmergeist unterdrückte und den Ruf des amerikanischen Kapitalismus beschädigte.
Die Lehre aus der Ära Geneen ist eindringlich. Erfolg lässt sich nicht allein durch Kontrolle und Zahlen erzwingen. Systeme, die auf Misstrauen aufbauen und Überraschungen fürchten, mögen kurzfristig beeindruckende Resultate erzielen. Langfristig aber zerstören sie das, was Unternehmen wirklich stark macht: die Fähigkeit zu innovieren, Risiken einzugehen und echtes Unternehmertum zu fördern. Harold Geneen baute ein Imperium, das mit ihm stand und fiel – und genau darin liegt sein größtes Versagen.
Quellen:
ITT: Weltkonzern zwischen Politik und Profit
Aufstieg und Fall eines Weltkonzerns