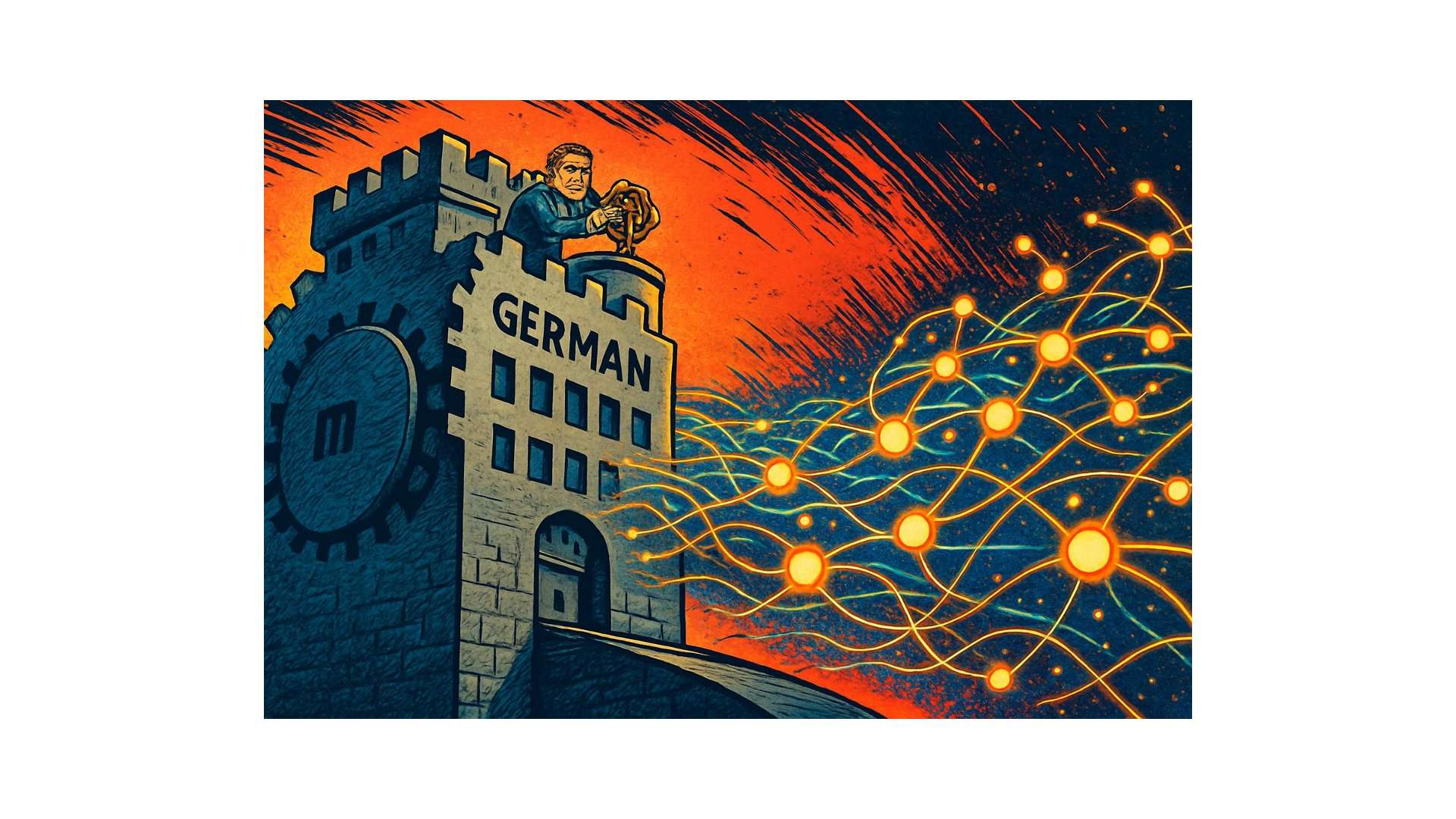Netzwerkhandlungsfähigkeit erfordert nicht nur neue Prozesse, sondern eine andere organisationale Logik. Doch deutsche Unternehmen scheitern bereits an der Grundfrage: Wie bleibt man anschlussfähig in Systemen, die man nicht kontrolliert? Die Antwort liegt nicht in Transformationsprogrammen, sondern im Verzicht auf Eindeutigkeit.
Die Frage nach der organisationalen Transformation für Netzwerkhandlungsfähigkeit wird in deutschen Unternehmen typischerweise als Change-Management-Problem behandelt. Man entwirft Transformationsfahrpläne, definiert Zielbetriebsmodelle, installiert agile Methoden, schult Führungskräfte in „Plattformdenken“. Das Grundmuster bleibt dabei immer gleich: Die Organisation soll planvoll von Zustand A nach Zustand B überführt werden. Genau diese Denkweise aber verhindert, was sie erreichen will. Denn Netzwerkhandlungsfähigkeit ist keine Eigenschaft, die man durch Reorganisation implementiert, sondern eine emergente Fähigkeit, die nur im Vollzug entstehen kann.
Beginnen wir mit dem Kernproblem: Anschlussfähigkeit. Niklas Luhmann hat diesen Begriff ins Zentrum seiner Systemtheorie gestellt. Anschlussfähigkeit bedeutet, dass eine Kommunikation an vorherige Kommunikationen anschließen und neue Anschlüsse ermöglichen muss. In hierarchischen Organisationen ist Anschlussfähigkeit eindeutig geregelt: durch Berichtslinien, Entscheidungskompetenzen, Prozessvorgaben. Die Kommunikation folgt vorgezeichneten Pfaden. In Netzwerken dagegen ist Anschlussfähigkeit radikal unbestimmt. Man weiß nie im Voraus, welche Kommunikation an welche anschließt, welche Verbindungen sich bilden, welche Interaktionen Wert schaffen.
Deutsche Unternehmen versuchen nun, diese Unbestimmtheit zu beseitigen. Sie definieren „Plattform-Governance-Strukturen“, legen fest, wer mit wem unter welchen Bedingungen interagieren darf, erstellen Regelwerke für Datenaustausch und Transaktionen. Das Ergebnis sind hybride Missbildungen: Netzwerke mit hierarchischer Steuerung, Plattformen mit Genehmigungsvorbehalten, Ökosysteme mit Zutrittsbarrieren. Man will die Vorteile der Netzwerkeffekte nutzen, ohne den Preis der Kontrollabgabe zu zahlen. Das funktioniert nicht. Ein kontrolliertes Netzwerk ist ein Widerspruch in sich.
Die grundlegende Transformation, die notwendig wäre, betrifft die organisationale Logik selbst. Hierarchien operieren nach dem Prinzip der Entscheidung: Eine höhere Instanz entscheidet, untere Instanzen führen aus. Netzwerke operieren nach dem Prinzip der Selektion: Alle Teilnehmer wählen ihre Interaktionspartner und Handlungsweisen selbst, und aus diesen dezentralen Selektionen emergiert ein Gesamtmuster. Das kann man nicht implementieren, man muss es zulassen. Doch Zulassen ist keine Managementtechnik, die sich in Projektplänen abbilden lässt.
Was würde es konkret bedeuten, anschlussfähig zu werden und zu bleiben? Zunächst einmal die Einsicht, dass Anschlussfähigkeit keine statische Eigenschaft ist, sondern ein permanenter Prozess. Man ist nicht einmal anschlussfähig und bleibt es dann. Jede Interaktion im Netzwerk verändert die Bedingungen für weitere Anschlüsse. Ein Unternehmen, das heute erfolgreich in eine Plattform integriert ist, kann morgen irrelevant werden, wenn sich die Interaktionsmuster verschieben, neue Akteure hinzukommen, Technologiestandards sich ändern.
Deutsche Unternehmen aber denken in Zuständen, nicht in Prozessen. Sie wollen den Zielzustand „Plattformmitglied“ erreichen und dann dort verharren. Die notwendige Daueranpassung, das permanente Experimentieren mit neuen Anschlusspunkten, die kontinuierliche Beobachtung und Neuorientierung – all das widerspricht tief verwurzelten Organisationsprinzipien. Deutsche Unternehmenskultur prämiiert Stabilität, Prozesstreue, Planbarkeit. Netzwerke erfordern Volatilität, Experimentierfreude, Unsicherheitstoleranz.
Hier kommt Pierre Bourdieu ins Spiel. Der organisationale Habitus deutscher Unternehmen ist nicht kompatibel mit Netzwerklogik. Habitus meint die inkorporierten, meist unbewussten Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsschemata, die durch jahrzehntelange Praxis entstanden sind. Deutsche Großunternehmen haben einen Habitus der Ingenieurslogik entwickelt: Probleme sind technisch lösbar, Prozesse sind optimierbar, Qualität ist kontrollierbar. Dieser Habitus funktioniert exzellent für hierarchische Wertschöpfung in stabilen Märkten. Er versagt komplett in nicht-trivialen Netzwerkumgebungen.
Man kann einen Habitus nicht durch Trainingsmaßnahmen ändern. Er sitzt zu tief, ist zu sehr in organisationalen Routinen, Karrieremustern, Belohnungssystemen verankert. Ein Ingenieur bei einem deutschen Automobilzulieferer, der 20 Jahre lang nach dem Prinzip „Spezifikation erfüllen, Qualität sichern, Termin halten“ gearbeitet hat, kann nicht plötzlich nach dem Prinzip „Experimentieren, Anschließen, Emergenz zulassen“ agieren. Das ist keine Frage des Wollens, sondern des Könnens. Der organisationale Habitus produziert eine strukturelle Unfähigkeit zur Netzwerkteilnahme.
Die Frage nach dem Umgang mit Ambiguitäten führt noch tiefer. Ambiguitätstoleranz gilt heute als Schlüsselkompetenz für digitale Transformation. Doch was heißt das konkret? Es bedeutet, aushalten zu können, dass eine Situation mehrere legitime Interpretationen zulässt, dass Handlungsoptionen nicht eindeutig bewertbar sind, dass Entscheidungen unter Ungewissheit getroffen werden müssen. Max Weber hat in seiner Bürokratietheorie beschrieben, wie moderne Organisationen gerade darauf ausgelegt sind, Ambiguität zu eliminieren. Durch Regeln, Verfahren, Hierarchien wird Eindeutigkeit hergestellt. Jede Situation soll einer klaren Kategorie zuordenbar sein, für die eine klare Handlungsanweisung existiert.
Netzwerke produzieren aber permanente Ambiguität. Die gleiche Interaktion kann unterschiedliche Bedeutungen haben, je nachdem, wer sie beobachtet. Ein Datenaustausch zwischen zwei Plattformteilnehmern kann Kooperation sein oder Wettbewerb, kann Wertschöpfung generieren oder Abhängigkeit erzeugen, kann strategisch zentral sein oder nebensächlich. Diese Mehrdeutigkeit lässt sich nicht auflösen. Sie ist konstitutiv für Netzwerke, weil Netzwerke aus heterogenen Akteuren mit unterschiedlichen Zielen und Perspektiven bestehen.
Deutsche Unternehmen reagieren auf diese Ambiguität typischerweise mit Komplexitätsreduktion durch Formalisierung. Man erstellt Verträge, die alle möglichen Interaktionsszenarien regeln. Man definiert Service-Level-Agreements, die eindeutige Leistungserwartungen schaffen. Man etabliert Governance-Gremien, die Konflikte autoritativ entscheiden. Das Problem: Mit jedem Versuch, Ambiguität zu beseitigen, macht man sich unanschlussfähiger. Denn andere Netzwerkteilnehmer, die flexibel und situativ agieren, meiden die Interaktion mit starren, formalistischen Akteuren. Die Anschlusspunkte werden weniger, nicht mehr.
Was wäre die Alternative? Organisationen müssten lernen, mit Mehrdeutigkeit produktiv umzugehen, statt sie zu bekämpfen. Das hieße: Entscheidungen treffen, obwohl man weiß, dass sie unter anderen Prämissen anders ausfallen würden. Kooperationen eingehen, ohne alle Eventualitäten vertraglich zu regeln. Ressourcen investieren, ohne den Return garantiert zu sehen. Positionen beziehen, die man möglicherweise wieder revidieren muss.
Hier zeigt sich die Crux: Ambiguitätstoleranz auf individueller Ebene ist eine psychologische Disposition. Ambiguitätstoleranz auf organisationaler Ebene erfordert strukturelle Voraussetzungen, die dem Wesen deutscher Großunternehmen widersprechen. Sie erfordert dezentrale Entscheidungsbefugnisse, damit unterschiedliche Deutungen parallel existieren können. Sie erfordert Fehlertoleranz, damit Experimente scheitern dürfen. Sie erfordert Redundanz, damit verschiedene Anschlusspunkte gleichzeitig bedient werden können. All das kostet Effizienz. Und Effizienz ist die Kardinaltugend deutscher Unternehmensführung.
Man sieht das Problem: Die Transformation zur Netzwerkhandlungsfähigkeit ist nicht eine Frage der richtigen Methode oder des richtigen Change-Programms. Sie erfordert eine fundamentale Neukonfiguration der Organisation, die deren Kernlogik in Frage stellt. Eine hierarchische Organisation kann sich nicht in ein Netzwerk transformieren und dabei hierarchisch bleiben. Sie muss sich selbst aufgeben – zumindest partiell.
Genau das aber wollen und können deutsche Unternehmen nicht. Sie wollen die Vorteile von Netzwerken nutzen, ohne die Nachteile der Hierarchieauflösung in Kauf zu nehmen. Sie wollen anschlussfähig sein, aber nach eigenen Regeln. Sie wollen mit Ambiguität umgehen, aber nur solange sie kontrollierbar bleibt. Diese Halbherzigkeit produziert die Zombie-Netzwerke, die die deutsche Wirtschaft bevölkern: formal existierende Plattformen ohne echte Nutzer, Ökosysteme ohne Dynamik, Kooperationen ohne Kooperation.
Die eigentliche Antwort auf die Frage „Wie transformieren wir unsere Organisation?“ lautet also: Gar nicht. Jedenfalls nicht im Sinne einer geplanten Transformation. Was möglich wäre: kleine, autonome Einheiten ausgründen, die außerhalb der Konzernlogik operieren dürfen. Experimente zulassen, die scheitern dürfen, ohne dass daraus Karrierekonsequenzen folgen. Kooperationen eingehen, bei denen man nicht die Kontrolle behält. Ressourcen in Netzwerke investieren, deren Return sich nicht kalkulieren lässt.
Doch das sind Hypothesen. Vermutlich wird es nicht geschehen. Denn es widerspricht zu fundamental den Strukturen, die deutsche Unternehmen so erfolgreich gemacht haben – in einer Welt hierarchischer Wertschöpfung. In einer Welt der Netzwerke produziert derselbe Habitus, der einst Exzellenz ermöglichte, nun strukturelles Versagen. Die Transformation, die notwendig wäre, ist zu radikal, um gewollt zu werden. Also bleibt man beim Bekannten: Man beziffert Netzwerkeffekte, definiert Plattformstrategien, startet Digitalisierungsinitiativen. Und scheitert. Wieder und wieder. Mit Ansage.