Bis zum Ausbruch des 1. Weltkrieges folgten bewaffnete Konflikte bestimmten Mustern. Wichtigstes Fortbewegungsmittel war das Pferd. Wer über genügend Verpflegung für Tier und Mannschaft verfügte, konnte die Truppen weit in das Land der Gegner führen. Die Streitmächte ließen sich auf einen überschaubaren Raum konzentrieren, wo nicht selten die Entscheidungsschlacht stattfand. Mit den Massenheeren, die sich nur noch zum Teil aus Berufssoldaten zusammensetzten und der Einführung neuer Technologien, wie der modernen Artillerie und dem Maschinengewehr, brach die Zeit der Millionenheere an. Damit veränderte sich das Gesicht des Krieges fundamental, so Martin von Creveld in Gesichter des Krieges. Der Wandel bewaffneter Konflikte von 1900 bis heute.
Im Laufe des folgenden halben Jahrhunderts (nach Gettysburg und Sedan, RK) änderte sich aber die Ausgangslage. Einerseits hatte die wachsende Zahl an Reservetruppen zur Folge, dass die Soldaten an der Front einen immer geringer werdenden Bruchteil aller Armeen ausmachten. Während im amerikanischen Sezessionskrieg wohl noch neun von zehn Mann Kombattanten gewesen waren, waren es 1914 nur noch fünf. Andererseits waren die Truppen an der Front angesichts der modernen Feuerkraft gezwungen, sich zu zerstreuen, sodass schließlich jeder Mann durchschnittlich etwa zwanzig mal so viel Platz einnahm wie ein Soldat zur Zeit Napoleons. Unterdessen waren die Armeen so sehr angewachsen, dass sie nicht mehr zehn- oder hunderttausend Mann zählten, sondern Millionen. Sie überstiegen damit bei weitem die Kapazitäten der Eisenbahnen, auf die sie für den Transport angewiesen waren. Angesichts der Transportprobleme und Versorgungsschwierigkeiten, die solche Menschenmengen mit sich brachten, bestand überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, die eigenen »Hauptkräfte« zusammenzuziehen und dem Gegner auf einem einzigen »Feld« eine »Schlacht« zu liefern. Umgekehrt bedeutete selbst ein dramatischer Sieg an der Front meist nicht mehr, als dass lediglich ein Bruchteil der gesamten gegnerischen Armee besiegt worden war.
Die räumliche Ausdehnung stellte die Kommunikation vor neue Herausforderungen:
Auch die Übermittlung von Mitteilungen sowie aller Arten von Informationen war ein Problem. Solange die Truppen an Ort und Stelle blieben und Kurieren durch schweres Artilleriefeuer nicht der Weg abgeschnitten wurde, konnte die Kommunikation zufriedenstellend funktionieren. Jeder Vorstoß hatte jedoch unmittelbar zur Folge, dass die wichtigsten Fernmeldeapparate – also drahtgestützte Telegrafen und Telefone – zurückgelassen werden mussten. Vorrückende Truppen konnten die Kabel hinter sich weiter verlegen und taten dies auch häufig. Das Ergebnis war jedoch meist nur eine notdürftige und unzuverlässige Kommunikationsmöglichkeit; der Versuch, die Kabel zu vergraben, hatte lediglich den Effekt, dass die Apparate noch unbeweglicher wurden. Außerordentlich schwierig war die Koordination des Artilleriefeuers mit den Bewegungen der Infanterie bei einem Angriff. Ohne funktionstüchtige, tragbare Funkgeräte war man auf das angewiesen, was Kundschafter, auch Beobachter, die von Flugzeugen aus operierten, in Erfahrung bringen konnten.
Ebenso betroffen war die Logistik:
Was für die Kommunikation galt, traf auch auf die Versorgung zu. Auf der Grundlage des Kriegs von 1870/71 stellte noch im Jahr 1883 ein berühmtes Werk die These auf, dass »im Vergleich zu der Nahrung für die Mannschaften und Pferde« alle anderen logistischen Anforderungen »verschwindend gering« seien. Tatsächlich war dies eine seit Beginn der Menschheitsgeschichte überlieferte Weisheit, und von 1914 bis 1916 verdreifachte sich das geschätzte Gewicht der erforderlichen Nachschubmenge, die eine normale Infanteriedivision einsatzfähig machte, in der Tat von 50 auf 150 Tonnen pro Tag. Den größten Anteil des Anstiegs beanspruchten die Munition für schnellfeuernde Waffen (Geschütze ebenso wie Maschinengewehre), Ersatzteile und Baumaterialien, die für Gräben benötigt wurden. Als sich die Zahl der Motorfahrzeuge und Flugzeuge gegen Ende des Krieges vervielfachte, kam noch Treibstoff hinzu; im Jahr 1918 verbrauchte allein die deutsche Luftwaffe monatlich 7.000 Tonnen Benzin.
Im Zweiten Weltkrieg bildeten die verschiedenen Waffengattungen und -systeme, Heer, Luft, Marine, eine Einheit. Technologische Innovationen waren der Schlüssel zum Erfolg – eigentlich:
In technischer Hinsicht waren die Deutschen sehr erfindungsreich. … Diese Findigkeit konnte sich jedoch auch als Nachteil erweisen. Sie hatte eine sehr große Zahl verschiedener Typen, Modelle und Versionen von Waffen zur Folge, was wiederum häufige Änderungen, Unterbrechungen des Produktionszyklus und endlose Wartungsprobleme nach sich zog. Ende 1941 brauchte die Heeresgruppe Mitte, die an der Front vor Moskau kämpfte, eine Million verschiedene Ersatzteile.
Ohne externe Expertise waren moderne Kriege nicht mehr zu führen.
Vor allem vier Felder waren mittlerweile so komplex geworden, dass nicht einmal Regierungschefs und Minister, die für die Kriegsführung zu Lande und zur See zuständig waren, ja häufig sogar nicht einmal die Oberbefehlshaber selbst sie verstanden, sondern Experten – oft Zivilisten – um Rat fragen mussten. Dabei handelte es sich erstens um den eigentlichen Vorgang der Forschung und Entwicklung; zweitens um die ständig wechselnden, ständig abgeänderten Waffen und Waffensysteme, die daraus hervorgingen; drittens um operative Forschung, mit dem Ziel, die beste Einsatzmethode für die Waffen und Waffensysteme zu finden; und viertens um die Nachrichtenbeschaffung. … Im Zweiten Weltkrieg scharten viele politische Entscheidungsträger und Befehlshaber wissenschaftliche Berater um sich. Sie sollten, so gut sie eben konnten, beurteilen, welche der unzähligen Entwürfe realisierbar waren, welche nützlich waren und welche noch rechtzeitig in Betrieb genommen werden konnten. Durch diesen Anreiz machte die Technologie gewaltige Fortschritte. Zu den wohl entscheidendsten Bereichen zählte der Radar. die Briten, die in den dreißiger Jahren wie besessen an der Luftabwehr arbeiteten, waren die Vorreiter bei der Verwendung des Radars für diesen Zweck sowie bei der komplexen Kommunikationsinfrastruktur, die erforderlich war, um die Apparatur mit dem Fighter Command zu koordinieren. Die Deutschen setzten als Erste Radar auf der See ein.
Der technologische Wettlauf führte zu immer neuen Erfindungen, die vom Gegner jedoch schnell kopiert wurden:
Nur selten war ein technologischer Vorsprung von langer Dauer; manche Erfindungen wie Annäherungszünder wurden sogar aus Angst zurückgehalten, der Feind werde sie kopieren. Zu Beginn des Krieges gelang es Deutschland und Japan, aus eigener Kraft auf technischer Ebene mitzuhalten, doch vor allem die japanischen Forschungsbemühungen hatten sich schon immer auf eine schmale Basis gestützt. Von 1942 an blieben die Japaner immer weiter hinter ihren Gegnern zurück. Die Deutschen waren in einer besseren Ausgangsposition, trafen auf dem Feld der Elektronik bis zum Ende des Krieges Abwehrmaßnahmen gegen die meisten Entwicklungen der Alliierten und leisteten in den oben genannten Feldern Pionierarbeit.
Einen legendären Ruf erlangte das Projekt Ultra des britischen Militärs. Vor allem dank des genialen Alan Turing gelang es, die Verschlüsselungsmaschine Enigma, über welche die geheimen Funksprüche der Wehrmacht versendet wurden, zu knacken[1]Vgl. dazu: Bletchley Park[2]Vgl. dazu: The Imitation Game – Ein streng geheimes Leben.
Im Jahr 1939 verfügten alle großen Kriegsparteien über Geräte zur Verschlüsselung ihrer Funksprüche, auch wenn manche eindeutig besser arbeiteten als andere. Gleichzeitig verfügten alle Kriegsparteien über Organisationen, die sich auf das Abfangen von Botschaften, ihre Entschlüsselung und die Umwandlung in Informationen spezialisiert hatten, welche die Entscheidungsträger verwerten konnten. .. Gerade zu der Zeit, als die Briten den Code der deutschen Kriegsmarine knackten, gelang zum Beispiel dem sogenannten B-Dienst der Marine genau das Gleiche bei ihren Gegnern.
Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte sich in Militärkreisen die Auffassung durch, dass die zahlenmäßige Überlegenheit für einen Sieg nicht mehr ausreichte. Defizite in der Quantität ließen sich durch den Einsatz überlegener Technologien zumindest ausgleichen. Ein Standpunkt, den Creveld infrage stellt:
Den Sieg, den die Koalitionstruppen im Jahr 1991 im Irak errangen, verdankten sie mindestens ebenso sehr der überwältigenden materiellen Überlegenheit wie dem technologischen Vorsprung, den sie vor den irakischen Streitkräften hatten. Wenn die NATO im Jahr 1999 Serbien besiegte, so lag das vor allem daran, dass die Flugzeuge der Koalition, die von Stützpunkten außerhalb der Reichweite ihrer Feinde starteten, die serbische Luftwaffe im Verhältnis 40:1 übertrafen. Und wenn die Vereinigten Staaten den Irak 2003 zum zweiten Mal besiegten, so bewies das nur, dass ein Elefant, wenn er auf eine Ameise tritt, dieselbe dabei zermalmt. .. So gesehen diente das Gerede von der Qualität, die angeblich an die Stelle der Quantität getreten war, nur dazu, die Tatsache zu verschleiern, dass der Feind außerordentlich schwach gewesen ist.
Wären überlegene Technologien für den Erfolg tatsächlich entscheidend, dann hätten die Sowjetunion und später die USA sich nicht aus Afghanistan zurückziehen müssen[3]Vgl. dazu: Krieg in Afghanistan (1979–1989)[4]Vgl. dazu: Afghanistan – das sowjetische Trauma[5]Vgl. dazu: Jahrestag des US-Afghanistan-Abzugs. Ein Debakel für die Biden-Regierung; und nicht zu vergessen der Vietnamkrieg:
Geblendet von des Kaisers neuen Kleidern, sehen die meisten Menschen in diesen Studien den Beweis für Modernität und Fortschritt – sie behaupten zumindest, ihn darin zu sehen. In Wirklichkeit ist es häufig ein Zeichen der Irrelevanz, des Niedergangs und der Unfähigkeit, da viele der stärksten Truppen der Welt vergeblich versuchen, mit Gegnern fertig zu werden, die so viel kleiner und schwächer sind als sie, dass der Sieg eigentlich gar nicht in Frage stehen sollte. Und gerade weil die Bemühungen, mit ihnen fertig zu werden, so häufig vergeblich sind, vermehren sich diese Gegner explosionsartig und wagen immer tollkühnere Operationen. … Die mächtigste Kriegsmaschine der Geschichte verschlang fast 450 Mrd. Dollar im Jahr, mühte sich aber vergeblich, 20.000 bis 30.000 Rebellen zu besiegen. Ihre ultramodernen Sensoren, raffinierten Kommunikationsverbindungen und zahllose Computer konnten nicht verhindern, dass ihre Gegner nach Belieben schalteten und walteten, wo, wann und wie immer sie wollten. Drei Tage vor Weihnachten töteten die Rebellen sogar 19 US-Soldaten, während diese im befestigten Stützpunkt ihr Mittagessen einnahmen[6]INTERVIEW: MARTIN VAN CREVELD – „DIE GUERILLAS SIND BESSER“.
Was war der eigentliche Wendepunkt?
Wann erreichten die Streitkräfte des 20. Jahrhunderts den Höhepunkt der Macht, und wie gelangten sie in die Sackgasse von heute, wo einige der stärksten von ihnen den kleinen Gruppen häufig schlecht ausgebildeter und mangelhaft ausgerüsteter Terroristen hilflos gegenüberstehen? Die Antwort ist, dass am 6. August 1945 die Kombination aus einer sich ständig verbessernden Technik und einer immer größer werdenden Truppenstärke abrupt beendet wurde. Dieses Ende wurde durch die Detonation der ersten Atombombe über Japan herbeigeführt. .. Das Massensterben, das sich in Hiroshima vollzog, markierte mit Sicherheit den wichtigsten Wendepunkt in fast 300 Jahren Militärgeschichte. Ja, man kann sogar noch weiter gehen: Hiroschima und Nagasaki dürften der wohl wichtigste Wendepunkt gewesen sein, seit sich die Menschen zum ersten Mal organisierten und vor Zehntausenden Jahren mit Stöcken und Steinen in den Krieg zogen. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Militärgeschichte, vielleicht auch die Menschheitsgeschichte als solche, geradlinig in einer Richtung verlaufen. Von da an wurde sie zweifelsohne vom Kurs abgebracht und schlug eine neue Richtung ein.
Seitdem geraten militärstrategische Überlegungen irgendwann an einen toten Punkt:
Nachdem die Supermächte sich jahrzehntelang wütend angestarrt hatten, mussten die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion am Ende einsehen, dass die alten Regeln nicht mehr galten und dass man nur gewinnen konnte, wenn sich gar nicht erst auf ein Spiel einließ. Die übrigen Länder folgen eines nach dem anderen nach. Entweder hatten sie sich, wie China und Indien, zum Ziel gesetzt, den Supermächten die Stirn zu bieten, oder wie wollten, wie im Fall Israel, nur ihre eigenen Nachbarn abschrecken. Da niemals eine »wirksame« Verteidigung gegen einen atomaren Angriff entwickelt wurde, wagte es Präsident Bush selbst bei einem Kräfteverhältnis von tausend zu eins und trotz aller großen Worte über die »Achse des Bösen« nicht, gegen Nordkorea so vorzugehen wie gegen den Irak.
References
| ↑1 | Vgl. dazu: Bletchley Park |
|---|---|
| ↑2 | Vgl. dazu: The Imitation Game – Ein streng geheimes Leben |
| ↑3 | Vgl. dazu: Krieg in Afghanistan (1979–1989) |
| ↑4 | Vgl. dazu: Afghanistan – das sowjetische Trauma |
| ↑5 | Vgl. dazu: Jahrestag des US-Afghanistan-Abzugs. Ein Debakel für die Biden-Regierung |
| ↑6 | INTERVIEW: MARTIN VAN CREVELD – „DIE GUERILLAS SIND BESSER“ |

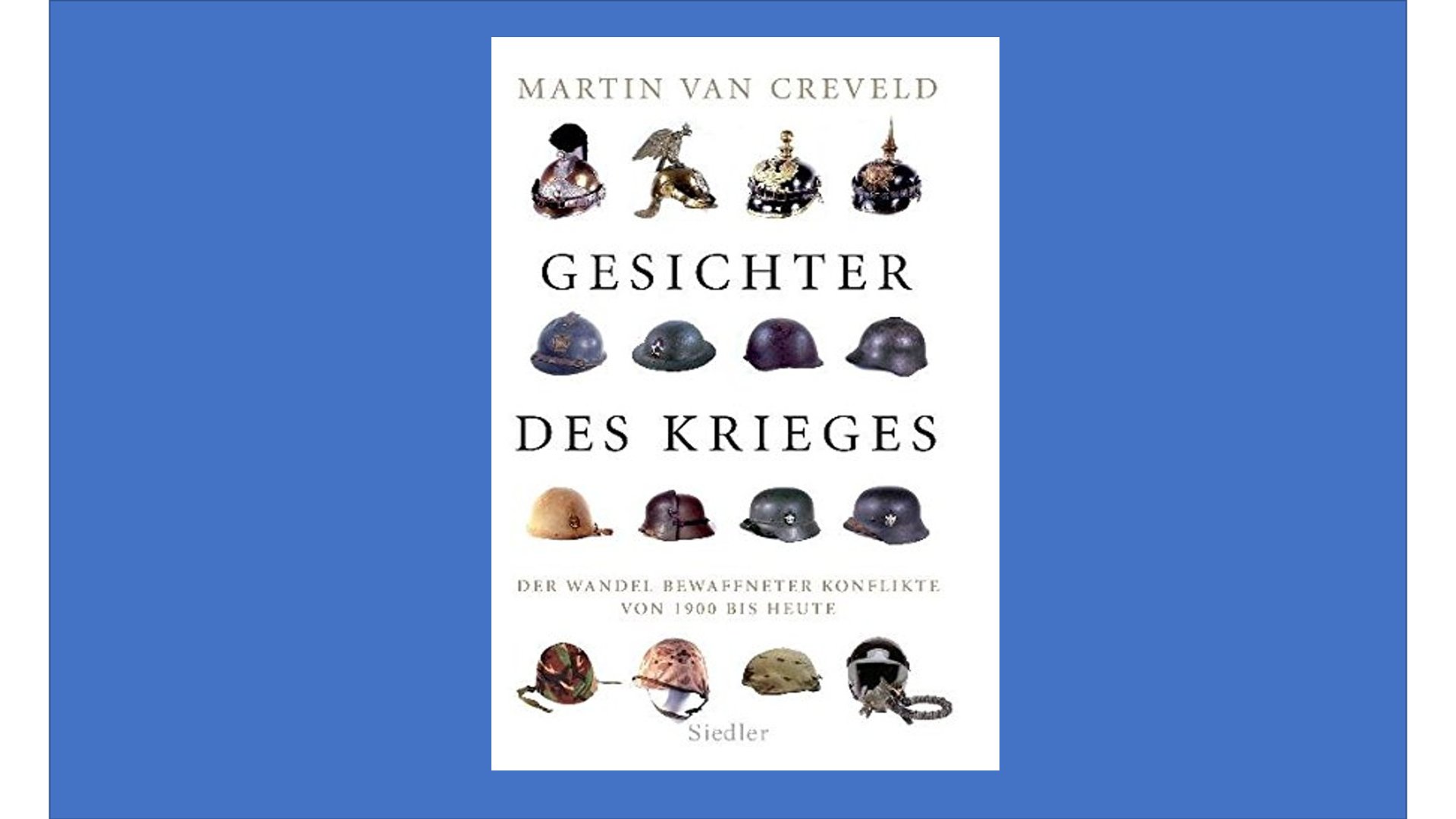
Kommentare sind geschlossen.