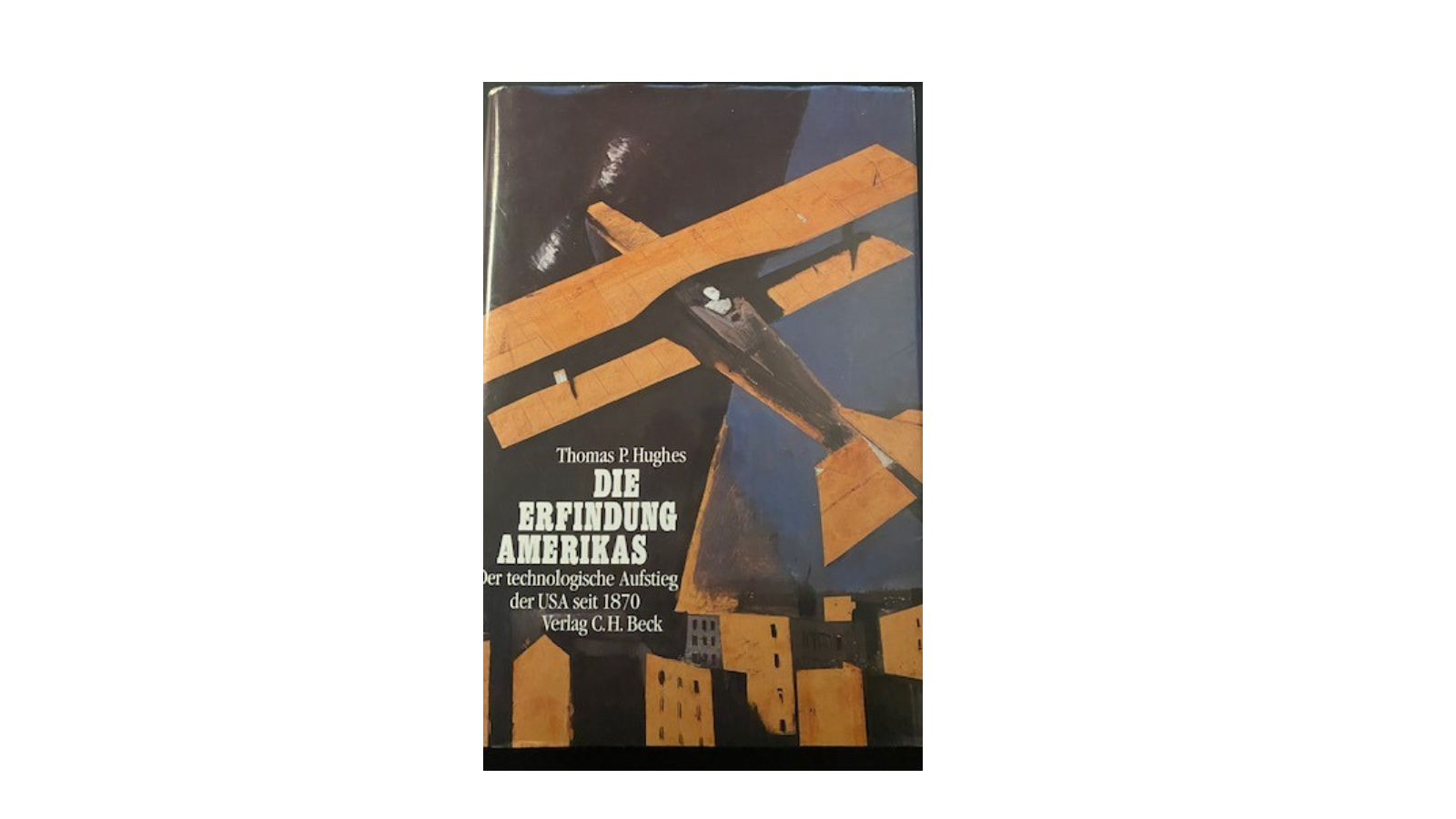Ohne den Erfindergeist ihrer Forscher und Unternehmer hätten die USA kaum den Aufstieg zur führenden Wirtschaftsmacht der Welt geschafft. Zwar waren andere Länder, wie Deutschland, ebenfalls technologischen Neuerungen gegenüber aufgeschlossen; so systematisch und methodisch wie die USA sind sie jedoch nicht vorgegangen. Angefangen hat alles mit selbständigen Erfindern, deren bekanntester Vertreter Thomas Alva Edison ist.
Bereits nach dem Bürgerkrieg stieg die Zahl der Patente in den USA deutlich an. Bis zur Jahrhundertwende entfiel die Mehrzahl der Patente auf unabhängige Erfinder.
Bevor um die Jahrhundertwende die industriellen Forschungsanlagen entstanden und lange bevor sich die großen von der Regierung finanzierten nationalen Laboratorien im Zweiten Weltkrieg mit der militärischen Verwendung der Kernkraft beschäftigten, konzentrierte sich das Bemühen um technische Erfindungen in den Werkstätten der unabhängigen Erfinder. … Wenn wir .. den Aufstieg der Nation zu ihrer industriellen und technologischen Bedeutung begreifen wollen, dann müssen wir Komplex, Charakter und Aktivitäten der unabhängigen Erfinder ergründen.
Laut Thomas Hughes begann die Ära der unabhängigen Erfinder, als Graham Bell das Telefon erfand und Edison im Jahr 1876 sein Menlo Park Laboratorium bezog. Diese Phase endete im 1. Weltkrieg.
Als es im ersten Weltkrieg der von Edison geleiteten Gruppe von Erfindern, die für die amerikanische Kriegsflotte arbeitete, nicht gelang, die ihr gestellte Aufgabe zu lösen, während eine Gruppe von Physikern bestimmte militärische Probleme bewältigen konnte, ging das Goldene Zeitalter der unabhängigen Erfinder zu Ende.
Neben Edison sind noch Elmer Sperry, Nikola Tesla und die Brüder Wright zu nennen. Die unabhängigen Erfinder nahmen nur zögernd die Rolle des Unternehmers an:
Die Erfinder begeisterten sich in erster Linie für ihre Erfindungen, und für sie war Kreativität das Wichtigste. Ihre unternehmerische Tätigkeit bei der Firmengründung hatte für sie nur den Zweck, ihre Erfindungen einem praktischen Nutzen zuzuführen. Sie mussten Firmen gründen, weil sie feststellten, dass schon bestehende Firmen, die sich bewährter Technologien bedienten, gewöhnlich nicht daran interessiert waren, sich radikalen neuen Technologien zuzuwenden, mit denen ihre Angestellten keine Erfahrungen hatten und für deren Herstellung ihre Maschinen und Verfahren nicht geeignet waren.
Jahre nach Hughes hat Clayton Christensen diese Haltung als „Innovators Dilemma“ bezeichnet[1]The Innovator’s Dilemma.
Ebenso ambivalent war die Einstellung der unabhängigen Erfinder der Wissenschaft und abstrakten Theorien gegenüber:
Für die selbständigen Erfinder waren die Naturwissenschaft und abstrakte Theorien nicht geeignet, sie in die Zukunft zu führen, denn ihre Forschungen gingen über die Grenzen dessen hinaus, was Technologie und Wissenschaft zu bieten hatten. Sie stießen in einen Bereich vor, der jenseits aller Theorien und geordneter Informationen war, mit denen es die Naturwissenschaft zu tun hatte. Die theoretischen Erkenntnisse, die den selbständigen Erfindern zur Verfügung standen, erklärten gewöhnlich den gegenwärtigen Wissensstand, nicht aber die Möglichkeiten, die noch weiter in der Zukunft lagen.
Bis zu einem gewissen Grad entspricht Elon Musk dieser Beschreibung bzw. Charakterisierung[2]Was Tesla von anderen Automobilherstellern unterscheidet.
Erst mit den großen industriellen Laboren, in denen Grundlagenforschung betrieben wurde, sollte sich das ändern.
Mit der steigenden Komplexität der technischen Lösungen und der Industriegesellschaft übernahmen die Gestalter und Manager großer Systeme die Führung. Einer von ihnen war Samuel Insull; ein anderer war Henry Ford. Insull, ein ehemaliger Mitarbeiter von Edison, ging als der Erbauer riesiger Energiesysteme in die Technikgeschichte ein.
Insull und andere Leiter großer städtischer und regionaler Stromnetze schufen Systeme zur Massenproduktion von Energie schon vor dem Entstehen des besser bekannten Ford-Systems und nahmen dabei dessen wesentliche Merkmale bereits vorweg. … Insull beteiligte sich an zahllosen Konferenzen, wo Ingenieure, Techniker, Unternehmer, Finanziers, Manager und andere ihre Erfahrungen und materiellen Ressourcen vereinigten, um die Probleme eines sich ausweitenden Systems zur Versorgung mit elektrischem Licht- und Kraftstrom zu lösen. Hier machte er sich die kreativen, problemlösenden, systematisierenden und expansionistischen Methoden des Systembauern zu eigen. Von Edison lernte er, Probleme dadurch zu lösen, dass man ein ganzes Netz aus Ideen, Maschinen und Methoden zusammenfügte. … Sie (Edison, Ford und Insull) haben alle drei in erster Linie nicht nach technischen, elektrischen oder chemischen Lösungen gesucht. Vielmehr glaubten sie, die Antworten auf ihre Fragen zu finden, wenn sie sich nicht an die Grenzen der einzelnen Fachgebiete hielten. Wenn sie ein Problem nicht mit technischen Mitteln lösen konnten, versuchten sie ihrem Ziel mit politischen oder ökonomischen Methodne näherzukommen.
Zwischen dem 1. und 2. Weltkrieg kam die Idee auf, die Wirtschaft und Gesellschaft dezentraler, regionaler zu organisieren. Einer der Vordenker war der Technikhistoriker Lewis Mumford.
Er glaubte, die geografische Region sollte anstelle der großen Industriestadt den Rahmen für die gesellschaftlichen und kulturellen Aktivitäten bilden. Bei seiner Definition des Regionalismus erinnerte er daran, dass vor der Einführung der Eisenbahn in den Vereinigten Staaten die industriellen Aktivitäten und die Bevölkerung innerhalb von geografischen Regionen verteilt gewesen waren.
In den 1960er und 1970er Jahren wurden die Gedanken von Mumford und anderer aufgegriffen. Beispielhaft dafür ist The Whole Earth Catalog[3]Whole Earth Catalog – der analoge Vorläufer des Internet. Im Zentrum der Planungen stand die Energieversorgung und die Einführung sog. sanfter Technologien, wie sie von dem Physiker Amory B. Lovins propagiert wurden.
In den nächsten 50 Jahren würden Erdöl und Erdgas als primäre Energiequellen für die Erzeugung von Elektrizität verbraucht werden, und der gesteigerte <<massive>> Energiebedarf würde mit elektrischem Strom gedeckt werden, der aus Kernenergie und Kohle erzeugt werden müsste. Der von Lovins empfohlene sanfte Weg sah eine <<alternative>> Zukunft vor, in der die großen Stromversorgungssysteme von kleinen, dezentralisierten Quellen für erneuerbare Energie abgelöst würden, indem man dazu überging, <<sanfte Technologien einzusetzen und Wind, Sonne und pflanzliche Stoffe zu nutzen. Diese sanften Technologien erforderten keine besonderen Spezialkenntnisse, und ihre Anwendung würde jedem verständlich sein.
Was die Chancen mehr oder weniger utopischer Entwürfe betrifft, dämpfte Hughes die Erwartungen:
Man könnte glauben, dass die Ablösung großer, zentral kontrollierter Systeme durch das Zusammenwirken von Zufälligkeiten, Katastrophen und Veränderungen verursacht wird, wobei das technologische Beharrungsvermögen gebrochen und aus sozial bedingten Umständen ein neuer technologischer Stil entsteht.
Übertragen auf unsere Zeit ließe sich fragen, ob die Finanzkrise von 2007/2008, das fast zeitgleiche Aufkommen von Bitcoin und kurz darauf die Gründung zahlreicher Startups zusammen mit der wachsenden Ungleichheit und dem Klimawandel ausreichen, um einen neuen technologischen Stil hervorzubringen.
Die Messlatte liegt sehr hoch:
Ein Zusammentreffen äußerer Umstände, die ausreichten, der modernen Technologie und der modernen Kultur ihr Beharrungsvermögen zu nehmen und ihre Charakteristiken zu nehmen, müsste sich mit den Einflüssen vergleichen lassen, die in ihrem Zusammenwirken die erste industrielle Revolution in Großbritannien und die zweite … industrielle Revolution in den Vereinigten Staaten ausgelöst und ermöglicht haben.
Sind die Künstliche Intelligenz und das Web3 die Ingredienzen, derer es bedarf, um das Beharrungsvermögen der reifen technologischen Systeme aufzubrechen? Allerdings, so Hughes, gibt es ernstzunehmende Gegenkräfte, die zu verhindern suchen, dass das alte System abgelöst wird. Der digitale Euro könnte sich als ein solches Mittel erweisen, mit dessen Hilfe die Zentralbanken ihre Stellung zu bewahren versuchen. Die Geschäftsbanken könnten das Nachsehen haben. Im schlimmsten Fall würden sie weitgehend überflüssig. Die Kryptowährungen und Bitcoin wollen das Finanzsystem dagegen dezentral gestalten.
Kann das gelingen?
Hughes bleibt skeptisch:
.. die neuen Systeme, seien es elektronische, militärische, industrielle oder Computersysteme zeigen im allgemeinen hinsichtlich ihres Wachstums und der in ihnen wirkenden Kräfte das gleiche Muster. Gelegentlich geschieht es, dass in einer modernen Ära alte Systeme verschwinden; an ihre Stelle treten sehr oft größere und komplexere.
Mit BigTech, Kryptowährungen, Quantencomputing/Kryptografie, digitalem Euro, Künstlicher Intelligenz und dem Web3 wird bzw. würde die Wirtschaft noch komplexer. Schon jetzt können die Systeme nur noch mit Mühe einigermaßen stabil gehalten werden. Wie lässt sich das noch regulieren? Welches Gesellschaftsmodell setzt das voraus? Welcher Konsens darüber, für welche Zwecke die Automatisierung eingesetzt wird, ist nötig?
Noch mal Hughes:
Wenn wir nach den Möglichkeiten für Veränderungen fragen, dann geht es dabei um einen Konflikt zwischen dem technologischen Beharrungsvermögen und der sozialen Gestaltung der Technologie. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass zu den Kräften, welche die Technologie vorantreiben, menschliche Handlungen und Zielvorstellungen gehören, die schon in der Vergangenheit die Technologie gestaltet haben.
References