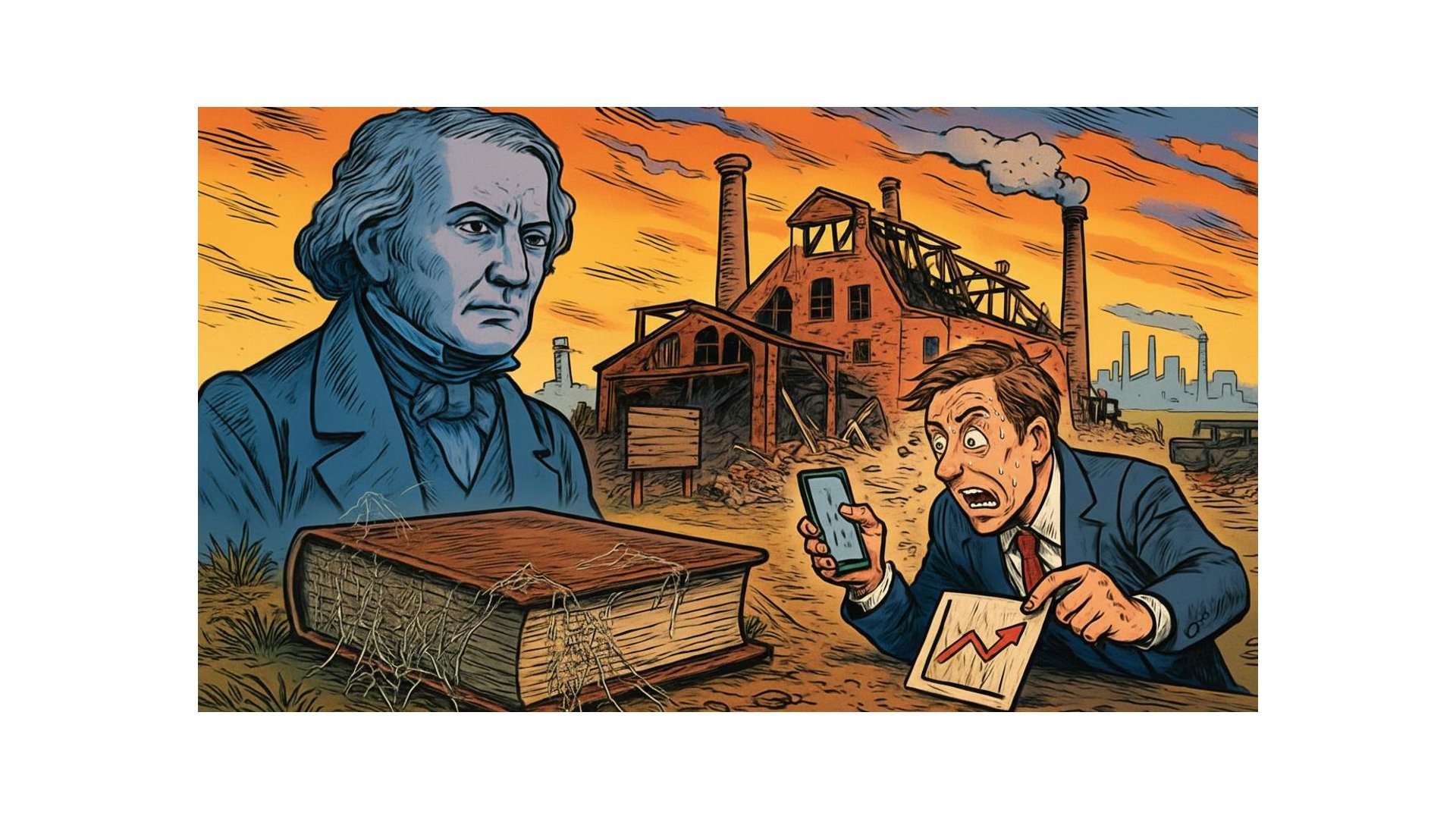Der vergessene Prophet: Wie Deutschland die Lehren seines bedeutendsten Ökonomen ignorierte – und warum ausgerechnet China sie beherzigt hat.
Es gehört zu den beißenden Ironien der Wirtschaftsgeschichte, dass ausgerechnet ein kommunistisches Land die Ideen eines deutschen Nationalökonomen des 19. Jahrhunderts konsequenter umsetzt als Deutschland selbst. Friedrich List, der 1841 sein Hauptwerk „Das nationale System der politischen Ökonomie“ veröffentlichte, würde die gegenwärtige Lage der deutschen Wirtschaft vermutlich mit einer Mischung aus Bestürzung und grimmiger Genugtuung betrachten. Bestürzung über das Ausmaß der strategischen Fehlentscheidungen. Genugtuung darüber, dass seine Warnungen sich bewahrheiten – wenn auch anderthalb Jahrhunderte später als gedacht.
Die vergessene Lektion
List war kein simpler Protektionist, als der er heute gelegentlich karikiert wird. Seine Kritik an Adam Smith und der klassischen Freihandelstheorie war differenzierter: Er akzeptierte den freien Handel als langfristiges Ideal, argumentierte aber, dass er nur zwischen Nationen auf vergleichbarem Entwicklungsstand funktioniere. Der von ihm geprägte Begriff des „Erziehungszolls“ impliziert gerade die Temporalität – Schutz bis zur Wettbewerbsfähigkeit, dann Öffnung. Das unterscheidet ihn fundamental von jenem Protektionismus, der als Dauerzustand gedacht wird.
Was List eigentlich beschäftigte, war die Frage der produktiven Kräfte einer Nation. Nicht der momentane Wohlstand interessierte ihn, sondern die Fähigkeit, Wohlstand zu erzeugen. Eine Volkswirtschaft, die ihre industrielle Basis erodieren lässt, mag kurzfristig von billigen Importen profitieren – langfristig verliert sie die Kompetenz, überhaupt etwas herzustellen. Diese Einsicht klingt heute, da deutsche Unternehmen ihre Produktion nach China verlagern und hiesige Werke schließen, erschreckend aktuell.
Das chinesische Paradox
Die Volksrepublik China praktiziert seit den Reformen unter Deng Xiaoping exakt jenes Programm, das List vor fast zweihundert Jahren skizzierte: strategische Industriepolitik, erzwungener Technologietransfer, temporärer Protektionismus für aufstrebende Branchen, massive Infrastrukturinvestitionen, systematischer Aufbau eines nationalen Innovationssystems. Die Resultate sind bekannt. China produziert heute nicht nur die billigen Konsumgüter, die westliche Ökonomen ihm großzügig zugestanden, sondern dominiert zunehmend jene Hochtechnologiesektoren, in denen Deutschland seine Zukunft wähnte.
List hätte diese Entwicklung mit einer gewissen Anerkennung verfolgt – nicht für das politische System, wohl aber für die strategische Konsequenz. Was ihn entsetzt hätte, ist die deutsche Reaktion darauf: eine Mischung aus Verleugnung, Hilflosigkeit und ideologischer Verbohrtheit. Während chinesische Strategen seine Werke studierten, erklärten deutsche Ökonomen den Freihandel zum unhinterfragbaren Dogma.
Die Anatomie eines Versagens
Die deutsche Wirtschaft hat sich in eine extreme Exportabhängigkeit manövriert. Rund vierzig Prozent des Bruttoinlandsprodukts hängen vom Export ab – eine Quote, die unter den großen Volkswirtschaften ihresgleichen sucht. List hätte darin genau jene Verwundbarkeit erkannt, vor der er warnte. Seine Konzeption zielte auf eine ausbalancierte Volkswirtschaft mit starkem Binnenmarkt, nicht auf ein merkantilistisches Modell, das von der Nachfrage anderer Nationen abhängt.
Der Verkauf von Schlüsselindustrien an ausländische Investoren hätte ihn entsetzt. Als der Augsburger Roboterhersteller KUKA 2016 an den chinesischen Konzern Midea ging, war das nicht bloß eine Unternehmenstransaktion. Es war die Preisgabe produktiver Kräfte, die sich nicht durch Kapitalrenditen aufwiegen lassen. List dachte in Kategorien der volkswirtschaftlichen Substanz, nicht der Aktionärsinteressen.
Ebenso kritisch hätte er die naive Annahme betrachtet, Deutschland könne dauerhaft High-End-Produkte exportieren, während die Wertschöpfungsketten darunter erodieren. Er verstand Volkswirtschaften als organische Systeme, in denen Zulieferer, Ausbildung, Forschung und Endproduktion zusammenhängen. Wer die Basis opfert, verliert irgendwann auch die Spitze.
Die fehlende Reziprozität im Handel mit China schließlich – deutsche Märkte offen, chinesische faktisch geschlossen – hätte List als strategischen Fehler bezeichnet. Nicht aus protektionistischer Ideologie, sondern weil symmetrische Bedingungen für ihn Voraussetzung echten Freihandels waren. Ein Spiel, bei dem nur eine Seite die Regeln befolgt, ist kein Freihandel. Es ist Selbstaufgabe.
Die unbequeme Frage
Allerdings wäre List auch unbequem für diejenigen, die ihn heute gern als Kronzeugen für Abschottung vereinnahmen. Er war kein Deglobalisierungstheoretiker. Sein Ziel blieb stets die Befähigung zur Teilnahme am Welthandel auf Augenhöhe, nicht der Rückzug in nationale Autarkie. Er würde vermutlich argumentieren, dass Deutschland nicht weniger Globalisierung braucht, sondern eine intelligentere – mit strategischer Autonomie in Schlüsselbereichen, diversifizierten Lieferketten und einem gestärkten europäischen Binnenmarkt als Gegengewicht zur chinesischen und amerikanischen Dominanz.
Die eigentlich unbequeme Frage, die List stellen würde, betrifft jedoch nicht Zölle oder Handelsabkommen. Sie betrifft ein fundamentales Versagen beim Aufbau neuer produktiver Kräfte. Warum hat ein Land mit dieser industriellen Tradition, dieser Ingenieurskultur, diesem Bildungssystem es versäumt, in den digitalen Plattformökonomien auch nur ansatzweise mitzuspielen? Wo sind die deutschen Äquivalente zu Google, Amazon, Alibaba, Tencent?
Die Antwort liegt vermutlich darin, dass Deutschland Lists Denken in produktiven Kräften durch ein Denken in Effizienz und Kostenoptimierung ersetzt hat. Man perfektionierte das Bestehende, statt Neues zu wagen. Man verwaltete den industriellen Bestand, statt ihn zu transformieren. Man vertraute darauf, dass technische Exzellenz allein ausreiche – und übersah, dass die Spielregeln sich geändert hatten.
Was zu tun wäre
List würde heute wohl für eine europäische Industriepolitik plädieren, die diesen Namen verdient. Nicht die Subventionierung sterbender Branchen, sondern der strategische Aufbau von Kompetenzen in jenen Technologien, die das 21. Jahrhundert prägen werden. Künstliche Intelligenz, Quantencomputing, Biotechnologie, Energiespeicherung – in all diesen Feldern hat Europa Nachholbedarf, der sich mit Freihandelsrhetorik nicht beheben lässt.
Er würde für eine Neubewertung der Handelsbeziehungen mit China eintreten. Nicht Abschottung, aber Reziprozität. Nicht Konfrontation, aber Selbstbehauptung. Die Fähigkeit, Nein zu sagen, wenn die eigene industrielle Substanz auf dem Spiel steht.
Vor allem aber würde er für ein Umdenken in der wirtschaftspolitischen Philosophie plädieren. Weg von der Fixierung auf kurzfristige Effizienz, hin zu langfristiger Resilienz. Weg von der Ideologie des schlanken Staates, hin zu einem Staat, der strategische Interessen definiert und durchsetzt. Weg von der Vorstellung, der Markt werde es schon richten, hin zu der Einsicht, dass Märkte Rahmenbedingungen brauchen, die politisch gesetzt werden müssen.
Epilog
Friedrich List nahm sich 1846 in Kufstein das Leben, verbittert und verarmt, von den Zeitgenossen weitgehend ignoriert. Seine Ideen wurden erst Jahrzehnte später wirksam, als Bismarcks Deutschland den Aufstieg zur Industriemacht vollzog. Heute, da dieses industrielle Erbe unter Druck gerät, wäre es an der Zeit, den vergessenen Propheten wiederzuentdecken.
Nicht als Lieferanten einfacher Rezepte – die hatte er nicht. Sondern als Mahner, dass wirtschaftlicher Wohlstand auf produktiven Kräften beruht, die gepflegt werden müssen. Dass Freihandel kein Selbstzweck ist, sondern ein Mittel, das klug eingesetzt werden will. Und dass Nationen, die ihre strategischen Interessen aus der Hand geben, am Ende auch ihren Wohlstand verlieren.
Die Frage ist nicht, ob Deutschland Lists Lehren beherzigen wird. Die Frage ist, ob es dafür nicht bereits zu spät ist.