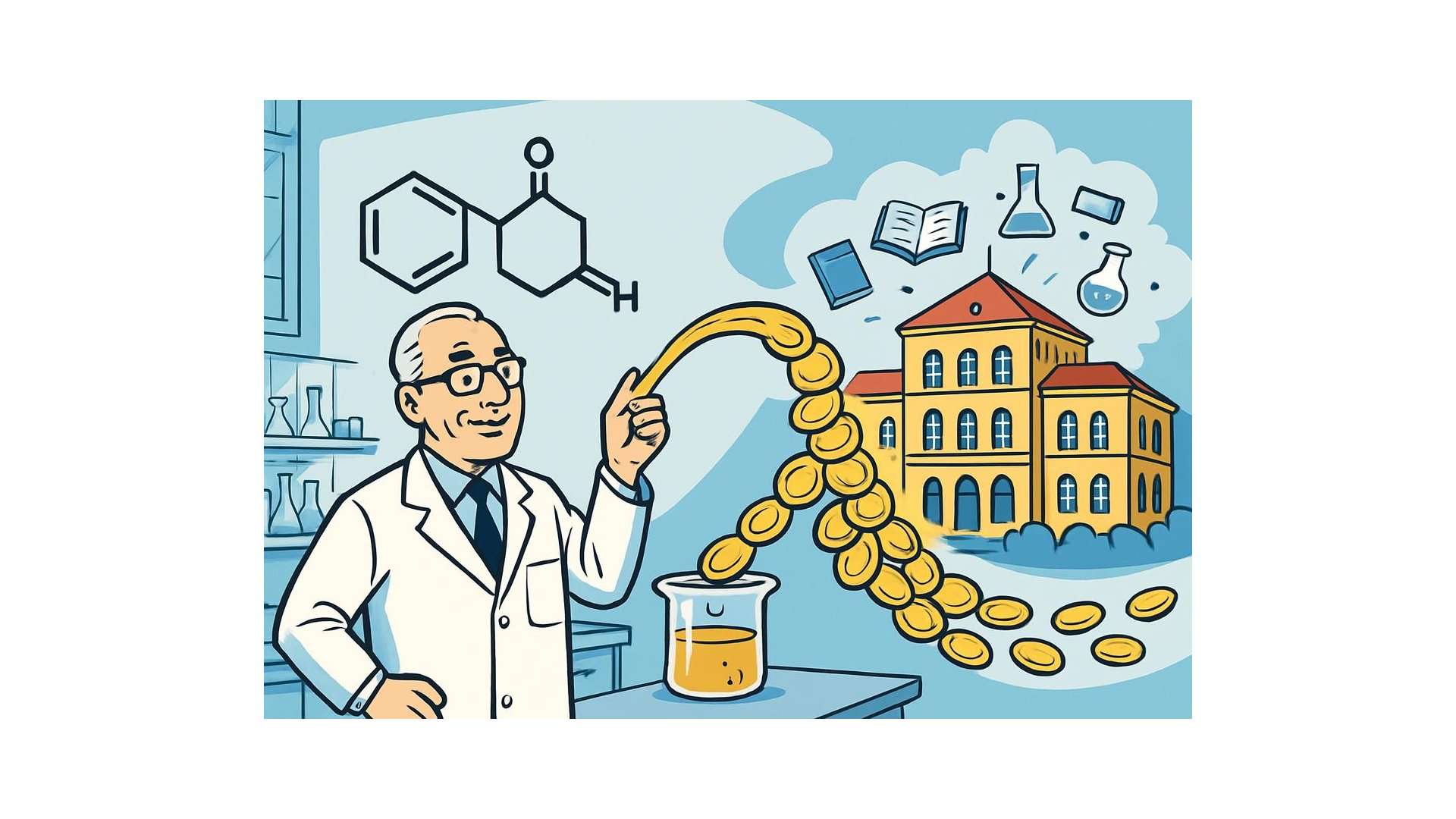Als Karl Ziegler 1953 am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung ein revolutionäres Verfahren zur Kunststoffherstellung entdeckte, ahnte niemand, dass daraus ein beispielloser, fast fünfzigjähriger Rechtsstreit werden würde. Die Geschichte des Ziegler-Katalysators zeigt eindrucksvoll, wie aus einer wissenschaftlichen Pionierleistung ein zähes juristisches Ringen um Patentrechte wurde – und wie ein Forschungsinstitut sich über Jahrzehnte aus den Erträgen einer einzigen Erfindung finanzieren konnte.
Ein Kunststück der besonderen Art
Es ist die Ausnahme, nicht die Regel: Ein öffentliches Forschungsinstitut, das sich über Jahrzehnte hinweg aus den Lizenzeinnahmen einer einzigen Erfindung selbst trägt. Dem Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mühlheim an der Ruhr gelang dieses wirtschaftliche und wissenschaftliche Kunststück mit einer Entdeckung, die einen völlig neuen Markt erschuf. Karl Ziegler, der spätere Nobelpreisträger für Chemie, entwickelte dort 1953 ein Verfahren zur Herstellung von Kunststoffen wie Polyethylen und Polypropylen. Bis heute werden basierend auf seinen Patenten jährlich mehrere Millionen Tonnen Polyolefine produziert – Grundstoffe, die aus unserem modernen Leben nicht mehr wegzudenken sind.
Das Prinzip, das blieb
Was macht eine Erfindung wirklich grundlegend? Im Fall des Ziegler-Katalysators zeigte sich die Antwort nach etwa zehn Jahren mit bemerkenswerter Klarheit. Die Wirkungsweise ließ sich zwar graduell und selektiv beeinflussen, doch in zahllosen Verbesserungsvorschlägen wurde das zugrundeliegende Prinzip weder überholt noch gefährdet. Die beiden Komponenten des Katalysators – eine Titan- beziehungsweise Übergangsmetallverbindung und eine Organoaluminiumverbindung – blieben unersetzlich.
Fast fünfzig Jahre nach der Entdeckung gab es keine kommerziell betriebene Polymerisationsanlage für Polypropylen, die auf diese beiden Komponenten verzichten konnte.
Diese wissenschaftliche Robustheit sollte sich als ebenso bedeutsam erweisen wie die wirtschaftliche Tragweite der Erfindung. Doch der Weg von der Laborentdeckung zur anerkannten, geschützten Innovation war alles andere als geradlinig.
Ein steiniger Weg durch die Instanzen
Was aus heutiger Perspektive zwingend und schlüssig erscheint, erwies sich in der Realität als mühsamer Kampf. Heinz Martin, einer der engsten Mitarbeiter Zieglers und selbst maßgeblich an der Entdeckung beteiligt, hält in seinem Buch „Polymere und Patente“ unmissverständlich fest: Die Durchsetzung des Patents war keineswegs ein Selbstläufer. Über die gesamte Laufzeit der Schutzrechte rissen die Versuche nicht ab, diese zu beseitigen, ihre Bedeutung zu bagatellisieren, sie zu umgehen oder vorsätzlich zu verletzen.
Dass die wissenschaftliche Weiterentwicklung der Ziegler-Katalysatoren nie zu einer kommerziell günstigeren Alternative führte, die das System hätte ersetzen können, war zweifellos ein Glücksfall. Doch mindestens ebenso wichtig war das hohe Können der Patentanwälte, die Ziegler und die Studiengesellschaft Kohle vertraten. Ihre profunde Kenntnis der jeweils nationalen Patentgesetzgebung und ihre präzisen Formulierungen in den Patentanmeldungen ermöglichten es, mögliche Lücken zu schließen, bevor sie zum Problem werden konnten.
Großkonzerne als Gegner
Die wirtschaftlichen Dimensionen der Erfindung lockten mächtige Gegner an. Industriegiganten wie Du Pont ließen nichts unversucht, um die Ansprüche des Max-Planck-Instituts zu verwässern und abzuschwächen. Das immense kommerzielle Interesse führte dazu, dass jeder auch nur halbwegs erfolgversprechende Weg beschritten wurde, um Ziegler, seinen Mitarbeitern und seinem Institut eine angemessene Teilhabe an den Früchten der Entdeckung zu verwehren oder zumindest zu beschneiden – mit juristischen ebenso wie mit wissenschaftlichen Argumenten oder auch durch schlichte Verletzung bestehender Schutzrechte.
In den meisten Fällen einigten sich die Parteien auf Vergleichszahlungen, die im Durchschnitt zwei Millionen Dollar betrugen. Über die Jahre kam dadurch eine durchaus ansehnliche Summe zusammen, die es dem Institut und seinen Forschern ermöglichte, weitere Prozesse durchzustehen und ihre Forschungsarbeit zu finanzieren. So entstand ein sich selbst tragendes System aus Innovation, Rechtsschutz und Forschungsförderung.
Die Crux des Patentrechts
Mit der Zeit wurde den Beteiligten am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung immer bewusster, wie wichtig – und wie herausfordernd – das Patentrecht für die Durchsetzung der Schutzrechte war. Ein wasserdichtes Patent anzumelden erwies sich als nahezu unmöglich, zumindest aber als außerordentlich schwierig.
Das grundsätzliche Dilemma bleibt weltweit dasselbe: Forscher erkennen das Prinzip eines neuen Verfahrens oder finden einen neuen Stoff, beanspruchen dies aber meist ohne ausreichende Beispiele. Die von ihnen geforderten weiten Anspruchsgrenzen werden von den Patentämtern jedoch nicht anerkannt. Die eilige Patentanmeldung auf ein interessantes Forschungsergebnis bleibt problembeladen – Abgrenzungsversuche sind für Forscher langweilig –, wenn nicht die Beschreibung so umfassend abgefasst wurde, dass Konkurrenten kaum Möglichkeiten erhalten, durch eigene Schutzrechtsanmeldungen in den geschützten Bereich einzudringen.
Ein Marathon ohne Sieger zu Lebzeiten
Die Gerichtsprozesse und juristischen Auseinandersetzungen zogen sich bis ins Jahr 1998 hin – über einen Zeitraum von fast fünfzig Jahren. Karl Ziegler selbst hat das Ende nicht mehr erlebt; er verstarb 1973, zwanzig Jahre nach seiner bahnbrechenden Entdeckung und nur ein Jahr nach der Verleihung des Nobelpreises.
Lohnt sich der Kampf?
Heinz Martin stellt am Ende seiner Betrachtungen grundlegende Überlegungen darüber an, in welchen Fällen ein solches Vorgehen angeraten ist. Neben der reinen Kosten-Nutzen-Abwägung kommen weitere Faktoren zum Tragen. Es gibt Wissenschaftler, die eine Erfindung grundsätzlich nicht unter Schutz stellen wollen und damit eine Verwertung zum Nutzen ihrer eigenen Forschungseinrichtung ablehnen.
Soll sich eine Institution wie ein Max-Planck-Institut einer Prozedur unterziehen, über einen Zeitraum von dreißig bis vierzig Jahren langwierige Auseinandersetzungen einzugehen? Die Antwort hängt sicherlich vom Verhältnis zwischen Gewinn und Aufwand ab – aber nicht nur. Für Patentjuristen ergaben sich in Patenterteilungsverfahren sowie Urteilsbegründungen unterer und höchster Gerichte neue Gesichtspunkte. Doch auch die chemische Forschung selbst wurde durch den Verlauf der gerichtlichen und patentamtlichen Auseinandersetzungen und nicht zuletzt durch die Patente selbst befruchtet.
Die Geschichte des Ziegler-Katalysators zeigt exemplarisch, dass wissenschaftliche Durchbrüche und ihre wirtschaftliche Verwertung zwei grundverschiedene Welten sind, die beide Ausdauer, Expertise und strategisches Geschick erfordern. Sie ist eine Erinnerung daran, dass Innovation nicht mit der Entdeckung endet, sondern oft erst dort richtig beginnt.
Quelle:
Polymere und Patente. Karl Ziegler, das Team, 1953-1998